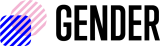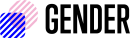Bei Geschlechtsdysphorie, Genderinkongruenz bzw. Transsexualismus empfinden die Betroffenen ein Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit zu ihrem körperlich eindeutigen Geschlecht sowie den gesellschaftlichen Rollenerwartungen. Damit geht meist auch der Wunsch einher, als Angehöriger des anderen Geschlechtes zu leben und anerkannt zu werden. Um das zu erreichen werden häufig chirurgische und hormonelle Behandlungen in Anspruch genommen, um den eigenen Körper dem bevorzugten Geschlecht so weit wie möglich anzugleichen.
In den vergangenen Jahren hat sich die Terminologie rund um „trans*“ vervielfacht. Wenn über Menschen im Kontext von Transsexualität gesprochen wird, reicht die Begriffsvielfalt von trans-gender zu trans-ident, von transsexuellem/r Mann/Frau zu trans*Mann/Frau, über bi-gender, trans*Personen, trans*Eltern, non-binary bis hin zu “Behandlungssuchende”. Dabei soll das Sternchen (*) die Vielfalt der möglichen Geschlechtsidentitäten auch außerhalb der klaren Einteilung in Mann und Frau repräsentieren. Bei der Entwicklung der Begriffe ist die Streichung und fehlende Bezugnahme auf das biologische Geschlecht („sex“) auffallend.
Die Biologie kennt keine Vielzahl der Geschlechter, sondern eine klare Einteilung in zwei Keimzelltypen und somit zwei Geschlechter: „männlich“ und „weiblich“. Was es jedoch gibt, ist eine Vielfalt neuer Merkmalskombinationen, die Produkt der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung ist.
Seit dem 1. Jänner 2022 ist in der ICD-11 (Internationale statistische Klassifiktion der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) nicht mehr von Transsexualismus, sondern von Genderinkongruenz, also einer Nichtübereinstimmung der empfundenen Geschlechtsidentität mit den Geschlechtsmerkmalen des Körpers, die Rede. Außerdem wird die nunmehrige Genderinkongruenz nicht mehr der Kategorie „Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“, sondern den „Problemen/Zuständen im Bereich der sexuellen Gesundheit“ zugeordnet. Differenzialdiagnosen, die im ICD-10 existierten wie „Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechterrollen“, „Sonstige Störung der Geschlechtsidentität“, „Sexuelle Reifungskrise“ oder „Sonstige psychosexuelle Entwicklungsstörung“, sind im ICD-11 ersatzlos gestrichen worden. Eine weitere Veränderung ist, dass der ICD-11 bei Genderinkongruenz als Diagnosekriterium keinen klinisch relevanten Leidensdruck oder die Beeinträchtigung in wichtigen Funktionsbereichen des Betroffenen mehr fordert.
Im amerikanischen Pendant, dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) ist Genderdysphorie weiterhin den psychischen Erkrankungen zugeordnet. Im Gegensatz zum ICD-11 („Genderinkongruenz“) verlangt die Diagnose Genderdysphorie einen Leidensdruck oder die Beeinträchtigung in wichtigen Funktionsbereichen des Betroffenen.
Geschichtlicher Rückblick:
Die Diagnose Transsexualismus tauchte erstmals 1975 in der ICD auf. Das seit 1948 von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene internationale Diagnoseklassifikationssystem wurde schon mehrmals überarbeitet, so auch die Einordnung von Transsexualismus. 1975 wurde Transsexualismus den „Sexuellen Verhaltensabweichungen und Störungen“ zugeordnet. In der 1990 überarbeiteten und bis Dezember 2021 gültigen Version (ICD-10) wurde Transsexualismus als „Störung der Geschlechtsidentität“ bezeichnet und den Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen zugeordnet.
Im DSM wurde der Begriff Transsexualismus erstmals 1980 eingeführt und der Kategorie „Psychosexuelle Störungen“ zugeordnet. 1994 wurde der Begriff Transsexualismus durch „Störung der Geschlechtsidentität“ ersetzt. 2013 entfernte man sich von dem Störungsbegriff und verwendet in der seither gültigen Fassung DSM-5 stattdessen den Begriff „Genderdysphorie“.
Quellen:
ICD-WHO
Bundeszentrale für politische Bildung
www.dimdi.de
Ziel der Hormonbehandlung ist es, die Hormone des körperlichen Geschlechts zu unterdrücken und die Hormone des Gegengeschlechts zuzuführen. Die Hormone werden in Tablettenform, durch Hormonpflaster oder Depotspritzen verabreicht.
Notwendig für eine Hormonbehandlung ist in Österreich der diagnostische und therapeutische Prozess. Beim diagnostischen Prozess gilt die sogenannte „dreifache Diagnostik“, die psychotherapeutische Diagnostik, die klinisch-psychologische Diagnostik und die psychiatrische Diagnostik. Darauf folgt der therapeutische Prozess, nach dem vor Beginn der Hormonbehandlung eine urologisch-gynäkologische Untersuchung, ein Risiko-Screening hinsichtlich Kontraindikationen und bei Bedarf auch eine zytogenetische Untersuchung durchgeführt werden muss. Zusätzlich bedarf es einer psychotherapeutischen Stellungnahme und einer anschließenden psychiatrischen Kontrolluntersuchung mit Indikationsstellung. Wenn es von keiner Seite Bedenken gibt, kann mit der Therapie begonnen werden, die aus der Einnahme gegengeschlechtlicher Hormone besteht.
Quelle: Stadt Wien
Bei Kindern und Jugendlichen:
In den österreichischen Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung werden Hormonbehandlungen in „vollständig reversible Interventionen“ und „partiell reversible Interventionen“ unterschieden. Frühestens können körperliche Interventionen nach dem Informationsgespräch am Ende der diagnostischen Phase nach Pubertätseintritt beginnen.
Vollständig reversible Interventionen können gemäß den Empfehlungen ab einem Pubertätsstadium Tanner 2–3 begonnen werden. Mittels einer pubertätsbremsenden Therapie mit GnRH-Analoga soll „mehr Zeit zur Erkundung der Geschlechtsidentität“ gewonnen und „später unerwünschte Geschlechtsmerkmale“ unterdrückt werden (sog. Pubertätsblockade/-suppression).
Partiell reversible Interventionen werden „ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen, möglichst mit Einverständnis der Obsorgeberechtigten. Im Unterschied zur Hormonbehandlung bei Erwachsenen wird die feminisierende/maskulinisierende Therapie der somatischen und emotionalen Entwicklung angepasst und die Dosis einschleichend im Sinne einer Pubertätsinduktion begonnen und sukzessive gesteigert. Wieder ist auf die nachhaltige Beeinträchtigung bzw. den Verlust der Fertilität hinzuweisen.“
Dass es sich bei der Hormontherapie mit GnRH-Analoga um eine vollständig reversible Intervention handelt, wurde von zahlreichen Experten und Studien widerlegt (mehr dazu in >> Auswirkungen der hormonellen Pubertätsblockade/-suppression). Die Erkentnisse führten etwa in Großbritannien zur Schließung der Transgenderklinik Tavistock.
Quelle: Sozialministerium
Diese Eingriffe sind schwerwiegend und meist irreversibel. Eine körperliche Geschlechtsanpassung erfordert oft mehr als nur eine Operation. Selbst wenn die geschlechtsangleichende Operation durchgeführt wurde, muss die Hormonbehandlung jedenfalls lebenslang erfolgen. Vor einer solchen Operation braucht es eine Stellungnahme der fallführenden Fachkraft (entweder ein Psychotherapeut oder ein klinischer Psychologe) und eine psychiatrische Kontrolluntersuchung. Danach erfolgt eine Zusammenfassung der beiden Stellungnahmen. Wenn von keiner Seite Bedenken kommen, kann mit der geschlechtsangleichenden Operation begonnen werden.
Quellen:
Bei Kindern und Jugendlichen:
Gemäß den österreichischen Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung sollen irreversible Interventionen wie Operationen an den Genitalien erst ab Volljährigkeit durchgeführt werden, nachdem die betroffene Person zumindest ein Jahr kontinuierlich in der angestrebten Geschlechtsrolle gelebt hat. Eine Mastektomie kann nach einer angemessenen Zeit des Lebens in der gewünschten Geschlechtsrolle, wobei das Wachstum abgeschlossen sein muss, bereits vor der Volljährigkeit durchgeführt werden (im Falle einer Hormonbehandlung, vorzugsweise nach der Dauer eines Jahres).
Quelle: Sozialministerium
Voraussetzungen für die Änderung der Geschlechtseintragung (Personenstandsänderung) für transidente Personen in Österreich:
- Vorhandensein einer „zwanghaften“ Vorstellung im falschen Geschlecht zu leben,
- Vornahme geschlechtskorrigierender Maßnahmen, die eine deutliche Annäherung an das äußere Erscheinungsbild des anderen Geschlechts gewährleisten,
- hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich am Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nichts mehr ändern wird.
Eine geschlechtsumwandende Operation gehört seit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 2008 nicht mehr zu den Voraussetzungen einer Änderung des Geschlechtseintrags.
Standesämter haben unter Berücksichtigung des vom Verwaltungsgerichtshof formulierten Voraussetzungen über Anträge auf Personenstandsänderung zu entscheiden.
Es gibt keine transsexuellen Kinder und Jugendlichen. Bei Kindern und Jugendlichen spricht man von Geschlechtsdysphorie, da die Persönlichkeit sich erst entwickelt. Die „Genderidentität“ ist das Ergebnis des Aufwachsens und kann daher nicht als „angeboren“ bezeichnet werden. Man kann also nicht „im falschen Körper geboren“ sein, erläutert der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Alexander Korte.
In der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie wird – vorausgesetzt, es findet keine hormonelle Behandlung statt – zwischen „Persistern“ und „Desistern“ unterschieden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die pubertätsblockierende Behandlung von Genderdysphorie in Kindheit und Frühadoleszenz faktisch immer irreversible konträrgeschlechtlich-hormonelle und chirurgische Maßnahmen nach sich zieht, wodurch sie den Betroffenen die Möglichkeit einer Überwindung der Geschlechtsdysphorie nimmt. „Desister“ sind diejenigen Betroffenen, die die Geschlechtsdysphorie überwinden beziehungsweise integrieren und zu einer hetero- oder homosexuellen Identitätsfindung gelangen. Bei „Persistern“ hingegen mündet die Genderdysphorie im Erwachsenenalter in einer dann so zu bezeichnenden transsexuellen Entwicklung. Es gibt vier aktuelle Studien, die sich mit der Entwicklung der Symptomatik von Genderdysphorie im Rahmen von Follow-Up-Studien beschäftigten. Eine Studie kam zum Ergebnis, dass lediglich 12 Prozent der weiblichen Probanden als „Persister“ und 88 Prozent als „Desister“ zu werten gewesen seien (vgl. DRUMMOND et al., 2008; 2017 Gender Clinic Toronto, CAN). Vier von 25 Mädchen gaben zum Follow-Up-Zeitpunkt eine homosexuelle, zwei von 25 eine bisexuelle Orientierung an. Zwei Drittel der Mädchen litten an komorbiden psychiatrischen Störungen. Eine weitere Studie, die Buben untersuchte, kam zu einem ähnlichen Ergebnis. 13,6 Prozent der Buben entwickelten sich zu „Persistern“, während 86 Prozent als „Desister“ lebten (vgl. SINGH, 2012 Gender Clinic Toronto, CAN). Eine niederländische Studie gelangte zu ähnlichen Ergebnissen. Über beide Geschlechter hinweg lag die „Persister“-Rate bei 27 Prozent. Die Mehrzahl der „Desister“ gab zum Zeitpunkt der Follow-Up-Befragung eine homosexuelle Orientierung an (vgl. WALLIEN & COHEN-KETTENIS, 2008 Utrecht Gender Clinic, NL). Eine weitere Studie über beide Geschlechter kam zu einer Rate von 15,8 Prozent „Persistern“ zu 84,2 Prozent „Desistern“ (vgl. STEENSMA & COHEN-KETTENIS, 2008; 2012 Gender Clinic Amsterdam, NL).
Gemäß den österreichischen Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung kann ab einem Pubertätsstadium Tanner 2–3 eine pubertätsbremsende Therapie mit GnRH-Analoga angeboten werden. Die Pubertätsblockade soll dem Jugendlichen mehr Zeit zur Erkundung der Geschlechtsidentität einräumen und später unerwünschte Geschlechtsmerkmale unterdrücken. Die Tanner-Stadien dienen der Stadieneinteilung von körperlichen Entwicklungsmerkmalen während der Pubertät. Sie klassifizieren die Entwicklung der Schambehaarung (Pubarche), der weiblichen Brust (Thelarche) und des männlichen Genitales (Gonadarche). In den Empfehlungen wird die Pubertätsblockade als „vollständig reversible Intervention“ beschrieben, was von vielen Wissenschaftlern und Experten mittlerweile widerlegt wurde (mehr dazu in >> Auswirkungen der hormonellen Pubertätsblockade/-suppression). Von der Pubertätssuppression zu unterscheiden sind die feminisierende/maskulinisierende Therapie mittels Hormonen, die ab 16 Jahren empfohlen wird. Im Unterschied zur Hormonbehandlung bei Erwachsenen wird die Therapie der somatischen und emotionalen Entwicklung angepasst und die Dosis einschleichend im Sinne einer Pubertätsinduktion begonnen und sukzessive gesteigert. Die in den österreichischen Empfehlungen als „partiell reversible Intervention“ beschriebene Hormonbehandlung hat die nachhaltige Beeinträchtigung bzw. den Verlust der Fertilität zur Folge.
Auswirkungen der hormonellen Pubertätsblockade/-suppression
Die Pubertätssuppression kann zur Minderung des IQs führen, allerdings sind die Studien zu den Risiken der Pubertätsblockade mit GnRH-Analoga, die als Arzneistoffe zur künstlichen Absenkung des Testosteron- oder Östrogen-Spiegels im Blut eingesetzt werden, spärlich. Eine Fallstudie ist zum Ergebnis gekommen, dass sich das Arbeitsgedächtnis und der Gesamt-IQ (nicht reversibel) signifikant verschlechterte (vgl. SCHNEIDER et al., 2017). Bekannt ist darüber hinaus die Beeinträchtigung der Knochengesundheit. GnRH-Analoga verlangsamen die Zunahme der Knochendichte in der entscheidenden Phase zwischen dem 10. und dem 20. Lebensjahr. Die Knochendichte ist jedoch auch bei transsexuellen Menschen, die gegengeschlechtlich behandelt werden, ohne eine Pubertätsblockade gehabt zu haben, niedriger als bei altersgleichen Kontrollprobanden. Dies zeigt, dass durch künstliche Hormonsubstitution kein ausreichender Aufbau der Knochenmasse erreicht werden kann. Bei Betroffenen, die sowohl eine Pubertätsblockade hatten und bei denen später eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung durchgeführt wird, könnte nicht nur die Summe der negativen Effekte auf die Knochendichte, sondern eine Potenzierung eintreten, befürchten Wissenschaftler. Eine sichere und unbestrittene Folge von GnRH-Analoga im Falle von konsekutiver gegengeschlechtlicher Hormontherapie ist die bleibende Infertilität und damit der Verlust der Reproduktionsfunktion. Eine mögliche und wahrscheinliche Folge von Pubertätssuppression ist außerdem die dauerhafte Beeinträchtigung der sexuellen Erlebnisfähigkeit. Zusammenfassend gehen Wissenschaftler davon aus, dass die pubertätsblockierende Behandlung von Genderdysphorie in Kindheit und Frühadoleszenz faktisch immer irreversible konträrgeschlechtlich-hormonelle und chirurgische Maßnahmen nach sich zieht, wodurch sie den Betroffenen die Möglichkeit einer Überwindung der Geschlechtsdysphorie nimmt. Gegen die Pubertätsblockade spricht außerdem die fehlende emotional-kognitive Reife des Kindes sowie die möglichen physischen, kognitiven und psychiatrischen Nebenwirkungen. Gleichzeitig beeinflussen GnRH-Analoge und Antiandrogene das sexuelle Erleben und verunmöglichen eine altersgerechte sozio-sexuelle Entwicklung. Das schließt wiederum die Gelegenheit aus, Erfahrungen für eine homosexuelle Identitätsfindung zu machen.
(Dr. Alexander Korte: Institut für Ehe und Familie)
In den letzten Jahren konnte ein enormer Prävalenzanstieg von Genderdysphorie bei Kindern und Jugendlichen festgestellt werden. Die britische Tavistock-Klinik hatte zwischen 2009 und 2018 einen Anstieg von registrierten und behandelten Minderjährigen um rund 4500 Prozent, mit einem Mädchenanteil von zuletzt fast 80 Prozent, verzeichnet. Der Anstieg insgesamt und die Frage, warum sich die Sex-Ratio, also das zahlenmäßige Verhältnis der betroffenen Geschlechter, verändert hat, ist bisher weitgehend ungeklärt (vgl. Aiken et al., 2015). Mit der veränderten Sex-Ratio beschäftigte sich die amerikanische Ärztin Lisa Littmann in einer Studie aus dem Jahr 2018 und kam zum Ergebnis, dass „das Unbehagen mit dem eigenen Körper“ nicht die eigentliche Ursache für Genderdysphorie sein könnte. Es zeigte sich vielmehr, dass bei 62,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die ein plötzliches trans-Outing in der Adoleszenz hatten („rapid-onset gender dysphoria“), bereits psychische Störungen wie Depressionen oder neurologische Entwicklungsstörungen wie Autismus diagnostiziert worden waren.
Erklärungsversuche
In der Psychiatrie hinlänglich bekannt ist die Tatsache, dass aufgrund des größeren „reproduktiven Investments“ von Frauen die psychische Integration des zur Reife gelangten Genital- und vor allem Reproduktionsapparats für weibliche Jugendliche deutlich schwerer ist als für männliche Jugendliche (sog. „Parental Investment Theory“, TRIVERS, 1972). Während 33 Prozent der Mädchen die Menarche als unangenehm und weitere 22 Prozent als ambivalent empfinden, haben nur 4 Prozent der Buben unangenehme Assoziationen im Zusammenhang mit Pubertät (vgl. eine Studie zum Sexualverhalten Jugendlicher von KLUGE, 1998). Der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Alexander Korte hält es daher für möglich, dass es sich vielmehr um einen Altersrollen- als um einen Geschlechtsidentitätskonflikt handeln könnte. Genderdysphorie bei Mädchen könne möglicherweise als Entwicklungskonflikt gedeutet werden, bei dem eine Diskrepanz zwischen mentaler, sozio-emotionaler und psycho-sexueller Entwicklung im Gegensatz zur körperlich-sexuellen Entwicklung entstehe.
Für Korte stellt sich die Frage, ob „trans*“ den Betroffenen nicht vielleicht als Identifikationsschablone diene. Seien Ende der 90er Jahre die Diagnosen „Borderliner“ oder „Multiple Persönlichkeit“ in Mode gewesen, bei der ebenso besonders weibliche Teenager betroffen gewesen seien, so gebe es heute einen „trans*-Boom“. „Trans*“ und ähnliche Kategorisierungen funktionierten auch als Sinnangebote, so Korte: „Sie geben den Jugendlichen die Möglichkeit, ihrem individuellen Leiden in einer zu ihrer Zeit und in ihrer Kultur akzeptierten Form Ausdruck zu verleihen.“ Gleichzeitig stelle die Kategorisierung Aufmerksamkeit, den Status des Besonderen und des Außergewöhnlichen in Aussicht. Laut Korte sei Genderdysphorie zwar keine Modeerscheinung, aber ein Zeitgeistphänomen. „Soziale Ansteckung“ halte er daher für möglich. In diesem Zusammenhang verweist der Mediziner darauf, dass psychiatrische Erkrankungen nicht einfach „da sind“, sondern Diagnosen und Klassifikationssysteme „gemacht“ werden (siehe >> Medizinischen Einordnung).
Quelle: Institut für Ehe und Familie
Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie bzw. Transsexualismus nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung (ab Volljährigkeit) – Österreich, Stand 20.06.2017 (zum Download)
Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung – Österreich, Stand 14.12.2017 (zum Download)
Weitere Leitlinien:
- World Professional Association for Transgender Health (WPATH) Standards of Care (zum Download)
- Standards der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen – Deutschland (zum Download)
- Von der Transsexualität zur Gender-Dysphorie – Schweiz (zum Download)
- Specialist service for children and young people with gender dysphoria – NHS England (zum Download)
- Guidance regarding gender critical views – UK Council of Psychotherapy (UKCP)
- Care of children and adolescents with gender dysphoria – Schweden (zum Download)
-
Medical Treatment Methods for Dysphoria Related to Gender Variance In Minors – Finnland (zum Download)
Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum Geburtsgeschlecht als Resultat kultureller und medientechnologischer Umbrüche?
Sturm und Drang im Würgegriff der Medien – Die Leiden der jungen Generation am eigenen Geschlecht, Alexander Korte und Volker Tschuschke, September 08, 2023
Das Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum Geburtsgeschlecht ist nicht neu, als Phänomen kann es bis in die antike Mythologie zurückverfolgt werden. Aber es war stets selten, wohingegen aktuell ein sprunghafter Anstieg von Abweichungen im Geschlechtsidentitätserleben bei Jugendlichen zu verzeichnen ist. Der Text geht dieser Problematik anhand der Frage nach, inwieweit diese Entwicklung auch ein Resultat kultureller und vor allem aber medientechnologischer Umbrüche ist, die bedingen, dass Jugendliche sich im „falschen Geschlecht“ wähnen und im Extremfall eine Transition anstreben. Die wichtigsten Eckpunkte des geplanten deutschen „Selbstbestimmungsgesetzes“ werden vorgestellt, das allerdings der zugrundeliegenden Problematik kaum gerecht werden dürfte. Der Text schließt damit, dass er diesbezüglich eine Reihe offener Fragen benennt, erste Antworten versucht und die Vorteile eines explorativen, genderkritischen gegenüber einem transaffirmativen Therapieansatz zusammenfasst.
Studie: https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000944
Geschlechtsumwandelnde Operationen verstärken Gefühl von Einsamkeit
Are transgender people satisfied with their lives?, Katharina Grupp, Marco Blessmann, Hans-Helmut König und André Hajek, BMC Public Health, 2023 volume 23, Article number 1002
Die Studie kam zum Ergebnis, dass sich die mentale Gesundheit von Transpersonen, die sich „geschlechtsumwandelnden“ Operationen unterzogen hatten, dadurch nicht verbesserte. Im Vergleich zu Transpersonen, die sich nicht operieren ließen, fühlten sich operierte Transpersonen einsamer.
Studie: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-023-15831-4
IEF-Artikel: https://www.ief.at/int-gender-transpersonen-fuehlen-sich-nach-geschlechtsumwandlungen-einsamer-und-depressiver/
Einsamkeit und soziale Isolation von Transpersonen
Loneliness and Social Isolation among Transgender and Gender Diverse People, Katharina Grupp, Marco Blessmann, Hans-Helmut König und André Hajek, Healthcare (Basel), 2023 May 22, 11(10): 1517
Die Studie untersuchte die hohe Rate von Einsamkeit und sozialer Isolation von Transpersonen in Deutschland. Diese war bei Transpersonen wesentlich höher als bei Cisgender Personen.
Studie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10217806/
IEF-Artikel: https://www.ief.at/int-gender-transpersonen-fuehlen-sich-nach-geschlechtsumwandlungen-einsamer-und-depressiver/
Einsatz von Pubertätsblockern ist „experimentell“ und kann irreversible Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern haben
A systematic review of hormone treatment for children with gender dysphoria and recommendations for research, J. F. Ludvigsson, J. Adolfsson et al., Acta Paediatrica April 2023
Für die systematische Übersicht bewerteten die Forscher mehr als 9900 Abstracts aus fünfzehn wissenschaftlichen Datenbanken und identifizierten 24 relevante Studien. Sie kamen zum Ergebnis, dass die Behandlung mit GnRHa irreversible Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern haben könnten, wie eine verminderte Knochendichte sowie die Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit. Die Forscher zogen außerdem den Schluss, dass die Evidenz zur Beurteilung der Auswirkungen einer Hormonbehandlung auf die Bereiche psychosoziale Auswirkungen, Knochengesundheit, Körperzusammensetzung und Stoffwechsel sowie Therapiepersistenz bei Minderjährigen mit Geschlechtsdysphorie unzureichend sei.
Studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16791
IEF-Artikel: https://www.ief.at/se_int-gender-schwedische-wissenschaftler-warnen-vor-dem-standardmaessigen-einsatz-von-pubertaetsblockern/
Psychische Erkrankungen und erhöhtes Risiko für Geschlechtsdysphorie
Attachment Patterns in Children and Adolescents With Gender Dysphoria, Kasia Kozlowska et al., 2021, Frontiers in Psychology, Volume 11 – 2020
Die australische Studie aus 2021 zeigt, dass die Gefahr für Kinder und Jugendliche, an Genderdysphorie zu erkranken höher ist, wenn sie unter einer psychischen Erkrankung leiden oder einen Verlust oder ein Trauma erlebt haben.
Studie: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.582688/full
Follow-Up Studien zum weiteren Verlauf der Genderdysphorie (Nachuntersuchung von Personen – in dem Fall mit Genderdysphorie – die zu einem früheren Zeitpunkt bereits untersucht wurden)
A Follow-Up Study of Boys With Gender Identity Disorder, Devita Singh, Susan J. Bradley et al., Front. Psychiatry, 29 March 2021, Sec. Public Mental Health Volume 12 – 2021
Die Studie untersuchte den weiteren Verlauf von Genderdysphorie bei Buben und kam zum Ergebnis, dass 12 Prozent als “Persister” lebten.
Studie: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.632784/full
A Follow-Up Study of Boys With Gender Identity Disorder, Devita Singh, Susan J. Bradley et al., Front. Psychiatry, 29 March 2021, Sec. Public Mental Health Volume 12 – 2021
Die Studie untersuchte den weiteren Verlauf von Genderdysphorie bei Buben und kam zum Ergebnis, dass 12 Prozent als “Persister” lebten.
Studie: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.632784/full
A Follow-Up Study of Boys With Gender Identity Disorder, Devita Singh, 2012, Department of Human Development and Applied Psychology, University of Toronto
Die Studie untersuchte den weiteren Verlauf von Genderdysphorie bei Buben und kam zum Ergebnis, dass 13,6 Prozent der Buben sich zu „Persistern“ entwickelten, während 86 Prozent als „Desister“ lebten.
Book-Preview: https://www.proquest.com/openview/264c217707b1f9a739006f66303c01f8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
Erwähnt in IEF-Artikel: https://www.ief.at/at_de-gender-psychiater-plaediert-fuer-ergebnisoffene-und-gender-kritische-psychotherapie-bei-geschlechtsdysphorie/
A Follow-Up Study of girls with gender identity disorder, Kelley D. Drummond, Susan J. Bradley et al., Jan 2008, Developmental psychology 44(1):34-45. doi: 10.1037/0012-1649.44.1.34.
Die Studie kam zum Ergebnis, dass lediglich 12 Prozent der weiblichen Probanden als „Persister“ und 88 Prozent als „Desister“ zu werten gewesen seien. Vier von 25 Mädchen gaben zum Follow-Up-Zeitpunkt eine homosexuelle, zwei von 25 eine bi-sexuelle Orientierung an. Zwei Drittel der Mädchen litten an komorbiden psychiatrischen Störungen.
Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18194003/
Erwähnt in IEF-Artikel: https://www.ief.at/at_de-gender-psychiater-plaediert-fuer-ergebnisoffene-und-gender-kritische-psychotherapie-bei-geschlechtsdysphorie/
Psychosexual outcome of gender-dysphoric children, Madeleine S. C. Wallien und Peggy T. Cohen-Kettenis, 2008, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2008 Dec, 47(12):1413-23
Die Studie untersuchte den weiteren Verlauf von Genderdysphorie beider Geschlechter. Über beide Geschlechter hinweg lag die „Persister“-Rate bei 27 Prozent. Die Mehrzahl der „Desister“ gab zum Zeitpunkt der Follow-Up-Befragung eine homosexuelle Orientierung an.
Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18981931/
Erwähnt in IEF-Artikel: https://www.ief.at/at_de-gender-psychiater-plaediert-fuer-ergebnisoffene-und-gender-kritische-psychotherapie-bei-geschlechtsdysphorie/
Korrelation zwischen Peer Group, Social Media und Geschlechtsdysphorie
Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria, Lisa Littman, 2018, PLOS ONE 13(8): e0202330
Lisa Littman, Soziologin an der Brown University, Rhode Island (US) untersuchte in ihrer Studie Aussagen von Eltern, die beobachteten, dass ihre Kinder plötzliche Anzeichen von Geschlechtsdysphorie, also dem Empfinden im falschen Geschlechts zu sein, aufwiesen. Eltern beschrieben, dass dies oft nicht nur bei einem Jugendlichen auftrat, sondern dieses Phänomen zeitgleich auch bei weiteren Jugendlichen im Freundeskreis beobachtet wurde. Eltern berichteten in Littmans Erhebungen außerdem, dass sie kurz vor dem Anstieg der Anzeichen für eine Geschlechtsdysphorie einen verstärkten Gebrauch von Social Media bei den Jugendlichen wahrgenommen hatten. Daraus schloss Littmann, dass sowohl Freunde aus der Peer Group als auch Social Media Einflüsse auf das oft plötzlich und stark aufkommende Gefühl, im falschen Geschlechtskörper zu sein, haben.
Die Studienergebnisse riefen Proteste von Transgender-Aktivisten hervor – das führte zu einer Überarbeitung der Studie, das Ergebnis blieb aber gleich.
Überarbeitete Studie: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214157
IEF-Artikel: https://www.ief.at/usa-gender-studie-bestaetigt-zusammenhang-zwischen-social-media-konsum-und-steigendem-transgender-empfinden/
Systemische Fehler in Studien und Artikeln zur Lebensqualität von Transgender-Personen
Nobili, A., Glazebrook, C. & Arcelus, J. Quality of life of treatment-seeking transgender adults: A systematic review and meta-analysis. Rev Endocr Metab Disord 19, 199–220 (2018)
Bei der Untersuchung von Studien und Artikeln zur Lebensqualität von Menschen mit einer Geschlechtsidentitätsstörung stellte man fest, dass bei fast allen Artikeln und Studien systematische Fehler bestehen (einmalig durchgeführte Befragungen, fehlende Kontrollgruppen, hohes Verzerrungspotential). Nur zwei Studien wurden als hochwertig bewertet. Bei anderen gab es vermehrt zu kurze Laufzeiten und viele Studienteilnehmer verließen die Studien vorzeitig.
Studie: https://doi.org/10.1007/s11154-018-9459-y
Honeymoon-Effekt nach einer geschlechtsumwandelnden Operation
Quality of life improves early after gender reassignment surgery in transgender women, Ebba K. Lindqvist et al., 2017, Eur J Plast Surg 40, 223–226
Die Studie fand heraus, dass es einen Honeymoon-Effekt kurz nach einer geschlechtsumwandelnden Operation gibt, die Lebensqualität von betroffenen Menschen im Vergleich allerdings immer noch ein niedrigeres Niveau aufweist. Die Zufriedenheit betroffener Personen beginnt nachweislich nach 3 Jahren zu sinken.
Studie: https://link.springer.com/article/10.1007/s00238-016-1252-0
Schlechterer IQ durch Pubertätsblocker
Brain Maturation, Cognition and Voice Pattern in a Gender Dysphoria Case under Pubertal Suppression, Maiko A. Schneider et al., 2017, Frontiers in Human Neuroscience Volume 11
Die Fallstudie kommt zum Ergebnis, dass sich das Arbeitsgedächtnis und der Gesamt-IQ durch die Hormonbehandlung im Zuge einer Pubertätsblockade signifikant und nicht reversibel verschlechterte.
Studie: https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00528
Erhöhte Suizidalität nach einer der geschlechtsumwandelnden Operation
Varied Reports of Adult Transgender Suicidality: Synthesizing and Describing the Peer-Reviewed and Gray Literature, Noah Adams et al., Transgender Health 2017 2:1, 60-75
Suizidphantasien und Selbstmordversuche von Menschen mit Geschlechtsidentitätsstörungen sind im Jahr nach der geschlechtsumwandelnden Operation mit 50,6 Prozent deutlich höher als vor der Operation mit 36,1 Prozent.
Studie: https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/trgh.2016.0036
Risikoreiche Geschlechtsumwandlung mit körpereigenem Gewebe
Lethal Necrotizing Cellulitis Caused by ESBL-Producing E. Coli after Laparoscopic Intestinal Vaginoplasty,
Ein 18-jähriger Teenager unterzog sich einer geschlechtsumwandelnden Operation. Die Ärzte versuchten, anhand von dessen Dickdarmgewebe eine Vagina nachzubilden. Der Teenager erlitt daraufhin einen septischen Schock und mehrere Organversagen, die schließlich zu seinem Tod führten.
Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27664856/
Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie
The Treatment of Gender Identity (Gender Dysphoria) Disorders in Childhood and Adolescence – Open-Outcome Psychotherapeutic Support or Early Setting of Therapy Course with the Introduction of Hormonal Therapy?, Alexander Korte et al., 2016, Sexuologie 23 (3-4) (1):117-132
Der Fachartikel setzt sich mit der Frage auseinander, ob eine ausgangsoffene psychotherapeutische Begleitung oder frühzeitige Festlegung und Weichenstellung durch Einleitung einer hormonellen Therapie bei Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsidentitätsstörungen als Behandlung eingesetzt werden soll.
Studienkritik
Long-Term Follow-Up of Adults with Gender Identity Disorder, Friedemann Pfäfflin und Ulrike Ruppin, 2015, Archives of Sexual Behavior volume 44, pages 1321–1329
Die Studie, die der Geschlechtsumwandlung viele positive Langzeitfolgen zuschreibt, wirft viele Fragen über ihre Aussagekraft auf. 49,3 Prozent der Teilnehmer sind im Verlauf der Studie weggefallen, was laut der Studie von D.W. Murray darauf hindeuten würde, dass bei ihnen nach einer Geschlechtsumwandlung gesundheitliche Komplikationen aufregten sind. Außerdem liefert die Studie keine zuverlässigen Ergebnisse, da sie eine Teilnehmerabbruchrate von über 20 Prozent aufweist (siehe Studie von Vicki Kristman 2004).
Studie: https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-014-0453-5
Suizidversuche von Transgenderpersonen
Suicide attempts among transgender and gender non-conforming adults, American Foundation for Suicide Prevention and The Williams Institute, Haas, A. P., Rodgers, P. L., Herman, J. L. (2014).
Die Prävalenz von Suizidversuchen beträgt unter Transmännern 46 Prozent und unter Transfrauen 42 Prozent, während lediglich 4,6 Prozent der gesamten US-Bevölkerung angaben, in ihrem Leben einen Suizidversuch unternommen zu haben.
Studie: https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Trans-GNC-Suicide-Attempts-Jan-2014.pdf
Erhöhte Suizidrate nach einer geschlechtsumwandelnden Operation
Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden, Cecilia Dhejne et al., 2011, PLoS ONE 6(2): e16885.
Personen nach einer geschlechtsumwandelnden Operation begehen 7,6-mal häufiger Selbstmordversuche als eine Kontrollgruppe und diese Versuche enden 19-mal häufiger tödlich.
Studie: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885
Erhöhte Sterblichkeitsrate nach Hormonbehandlung
A long-term follow-up study of mortality in transsexuals receiving treatment with cross-sex hormones, Henk Asscheman, 2011, Eur J Endocrinol. 164(4):635-42. doi: 10.1530/EJE-10-1038.
Bei Männern, die eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen, zeigt sich eine um 51 Prozent erhöhte Sterblichkeitsrate im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung (Selbstmord, Drogenmissbrauch, kardiovaskuläre Erkrankungen, AIDS).
Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21266549/
Korrelation zwischen Studienqualität und Teilnehmerabbruchquote
Loss to Follow-Up in Cohort Studies: How Much is Too Much?, Vicki Kristman und Pierre Côté, 2004, European Journal of Epidemiology 19(8):751-60
Vicki Kristman stellte in ihrer Studie klar, dass eine Teilnehmerabbruchquote von über 20 Prozent bei Studien zu einer Einschränkung der Verlässlichkeit der jeweiligen Studienergebnisse führt. Diese Studie ist unabhängig von der Transgenderthematik durchgeführt worden, ist aber von hoher Bedeutung, wenn man sich Studien zum Leben von Transgenderpersonen ansieht.
Teilnahmeabbruch nach Komplikationen
Loss to Follow-up Matters, D.W. Murray, A. R. Britton und C. J. K. Bulstrode, 1997, British Editorial Society of Bone and Joint Surgery 0301-620X/97/26975
Die Studie stellt fest, dass jene Teilnehmer für eine Studie verlorengehen, bei denen während des Studienverlaufs nach einer medizinischen Maßnahme schwerwiegende Probleme auftreten.
Studie: https://online.boneandjoint.org.uk/doi/pdf/10.1302/0301-620X.79B2.0790254
Österreich
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 27. Februar 2009, 2008/17/0054
Der Verwaltungsgerichtshof hat in dem Urteil entschieden, “dass ein schwerwiegender operativer Eingriff, wie etwa die von der belangten Behörde geforderte Entfernung der primären Geschlechtsmerkmale, keine notwendige Voraussetzung für eine deutliche Annäherung an das äußere Erscheinungsbild des anderen Geschlechts ist.”
Das Gericht formulierte daraufhin die Voraussetzungen, nach welchen die Personenstandsbehörde die Beurkundung des Geschlechts im Personenstandsregister zu ändern hat: “In Fällen, in denen eine Person unter der zwanghaften Vorstellung gelebt hat, dem anderen Geschlecht zuzugehören, und sich geschlechtskorrigierender Maßnahmen unterzogen hat, die zu einer deutlichen Annäherung an das äußere Erscheinungsbild des anderen Geschlechts geführt haben, und bei der mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass sich am Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nichts mehr ändern wird.”
EGMR-Entscheidungen
O.H. und G.H. gegen Deutschland / A.H. und andere gegen Deutschland, April 2023
In einem der beiden Fälle hatte eine Trans-Frau unter Berufung auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gefordert, als Mutter des mit ihrem Samen gezeugten Kindes amtlich eingetragen zu werden. Das zuständige Standesamt entschied, die als Mann geborene Klägerin nicht als Mutter in das Geburtenregister einzutragen, da sie das Kind nicht geboren habe. Stattdessen wird jene Person als Mutter geführt, die das Kind tatsächlich zur Welt gebracht hat. Beide Elternteile klagten gegen dieses Vorgehen. Im zweiten Fall ging es um die Beschwerde eines Trans-Mannes, der als „Vater“ seines Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen werden wollte. Der Kläger war als Frau geboren worden und hatte das Kind zur Welt gebracht, nachdem der Geschlechtswechsel von weiblich zu männlich bereits rechtlich anerkannt worden war. Zweitantragsteller im Verfahren war das geborene Kind.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschied, dass es rechtens ist, die biologische Vater- oder Mutterschaft ins Geburtenregister einzutragen, auch wenn der Elternteil vor oder nach der Geburt die Geschlechtsidentität gewechselt habe. Rechtens ist auch die Eintragung der Elternteile mit den ursprünglichen Vornamen. Die Deutschen Gerichte hätten einen fairen Ausgleich zwischen den Rechten der Beschwerdeführer, den Kindeswohlerwägungen und dem öffentlichen Interessens gefunden.
X. und Y. gegen Rumänen, 19.01.2021
Die Kläger versuchten eine Änderung ihres Geschlechtseintrags von „weiblich“ auf „männlich“ vor den nationalen Gerichten zu erwirken. Diese lehnten die Anträge mit der Begründung ab, dass sie „verfrüht“ seien und forderten die Antragsteller auf, eine Bestätigung über eine geschlechtsumwandelnde Operation vorzulegen.
Der EGRM sah darin eine Verletzung von Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK): Das nationale Recht in Rumänien sehe kein etabliertes Verfahren zur Änderung der Geschlechtsidentität vor. Die Möglichkeit, das Geschlecht vor den nationalen Gerichten ändern zu lassen, wurde zwar vom rumänischen Verfassungsgerichtshof im Jahr 2008 anerkannt. Damit sei auch eine rechtliche Basis zur Änderung des Geschlechts in Rumänien vorhanden. Diese sei jedoch in Bezug auf die Voraussetzungen, die für eine Änderung der Geschlechtsidentität zu erfüllen seien, nach Ansicht des Gerichtshofs zu vage und unbestimmt. Die nationalen Gerichte hätten dabei keine triftigen Gründe für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses, das der Änderung des Geschlechtseintrags im konkreten Fall entgegenstünde, vorgebracht und auch keine adäquate Interessensabwägung zwischen einem wie auch immer gearteten öffentlichem Interesse und dem Recht der Kläger auf Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität vorgenommen. Aufgrund des Fehlens von klaren und vorhersehbaren Verfahren, die eine rasche, transparente und leicht zugängliche Änderung des Namens und der Geschlechtseintragung in offiziellen Dokumenten ermöglichen würden, habe Rumänien im gegenständlichen Fall gegen Art. 8 EMRK verstoßen.
Großbritannien
Bell v Tavistock Dezember 2020 – Klage gegen britische Tavistock Klinik aufgrund von überstürzter Diagnose von Geschlechtsdysphorie und Behandlung
Die Diagnose “Geschlechtsdysphorie” wird in der Tavistock Klinik teilweise nach nur 3 Sitzungen gestellt und im Anschluss daran mit der Behandlung begonnen. Die Betroffene wurde nicht auf das Vorhandensein anderer psychischer Probleme hin untersucht. Die Geschlechtsumwandlung führte auch nicht zu einer Verbesserung ihrer Situation. Sie kämpfte mit Selbstmordgedanken und wollte wieder in ihrem biologischen Geschlecht leben. Sie reichte Klage gegen die britische Tavistock Klinik ein. Das Gericht gab der Klage des Mädchens statt. Der High Court sagte, dass Minderjährige nicht in der Lage sind, die weitreichenden Folgen des Einsatzes von Pubertätsblockern zu erfassen und daher eine Transgenderbehandlung für Minderjährige unzulässig sei.
Kanada
Supreme Court of British Columbia Judgement Transgender Boy against father April 2019
Ein Mädchen hatte in der Schule ohne das Wissen ihrer Eltern Informationen über Transgenderbehandlungen bekommen und wollte daraufhin ein Junge werden. Der Vater versuchte, die Behandlung seiner Tochter gerichtlich zu verhindern, das Gericht erlaubte jedoch die Behandlung und ordnete an, dass der Vater das Mädchen mit dem männlichen Pronomen anzusprechen habe.
Court of Appeal for British Columbia Judgement Transgender Boy against father Jänner 2020
Das Urteil des Supreme Courts of British Columbia wurde durch den Court of Appeal von British Columbia bestätigt. Der Vater kann es nicht verhindern, dass seine Tochter Hormonspritzen von den Ärzten bekommt. Er muss das Mädchen auch mit männlichem Pronomen bezeichnen und darf in den Medien nicht mehr über den Fall reden. Allerdings stellt sein Verhalten keine, wie im Urteil des Supreme Courts behauptete, familiäre Gewalt dar. Der Vater in Kanada ist nun verhaftet worden, weil er den Anordnungen des Gerichts nicht gehorcht hat und er seine 15-jährige Tochter als Mädchen anredete, obwohl sie mit dem männlichen Pronomen angesprochen werden wollte.
Richtlinie der des Schwedischen Karolinska Universitätskrankenhauses zur Aussetzung von Gender-Behandlungen bei Kindern, 2021 „Guideline Regarding Hormonal Treatment of Minors with Gender Dysphoria at Tema Barn – Astrid Lindgren Children’s Hospital (ALB)“
Die Klinik verweist in der Richtlinie unter anderem auf die Publikation der SBU (Swedish Agency for Health Technology of Social Services), in der zum einen auf die fehlenden Nachweise der Langzeiteffekte und zum anderen auf die Gründe für die starke Zunahme an Patienten in den letzten Jahren hingewiesen wurde. Darüber hinaus verwiest sie auf eine Studie des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) über den nicht nachweisbaren Nutzen einer Behandlung mit Pubertätsblockern und der gegengeschlechtlichen Hormontherapie.
IEF-Artikel: https://www.ief.at/se-gender-schwedisches-universitaetskrankenhaus-beendet-gender-behandlung-bei-kindern/
Publikation der Swedish agency for Health Technology of Social Services, 2019, “Gender dysphoria in children and adolescents: an inventory of the literature”
Die SBU weist auf die fehlenden Nachweise der Langzeiteffekte und auf die Gründe für die starke Zunahme an Patienten in den letzten Jahren hin.
Pressemitteilung, 2022, Warnung der französischen Nationalen Akademie der Medizin vor übereilten unumkehrbaren Transgender-Behandlungen
In Frankreich ist der Einsatz von Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen mit der Zustimmung der Eltern ohne Altersbeschränkung möglich. Chirurgische Eingriffe, vor allem Brustamputationen und Operationen an den externen Geschlechtsorganen sind ab 14 Jahren erlaubt. 2022 warnte die französische Nationale Akademie der Medizin in einer Presseaussendung davor, Kinder und Jugendliche, die ihr biologisches Geschlecht in Frage stellen, vorschnell mit gesundheitsschädlichen und unwiderruflichen Therapien zu behandeln. Auch wenn die Gründe für den Anstieg vielfältig sein mögen und von sozialer Akzeptanz bis Peer Pressure reichen können, sieht die Akademie in der Transidentität bei Kindern und Jugendlichen vor allem ein soziales Problem. Fälle und manchmal gar Cluster von Genderdysphorie würden oft in unmittelbarer Nähe auftreten.
Ein neues Gesetz des US-Bundesstaates Idaho verbietet künftig Geschlechtsumwandlungen bei Kindern unter 18 Jahren. Vom Verbot umfasst sind die Behandlung mit Pubertätsblockern, also Medikamenten, die die Bildung von Geschlechtshormonen stoppen, sowie chemische Kastrationen und Masektomien (Brustentfernungen) bei unter 18-Jährigen.
Anordnung des texanischen Gouverneurs Abbott an das Familienministerium, 2022
Der texanische Gouverneur, Greg Abbott, ordnete Ende Februar an, dass das Familienministerium Untersuchungen bei Ärzten und Eltern von Kindern, an denen Hormonbehandlungen oder geschlechtsumwandelnde Operation durchgeführt wurden, einleite. Auch Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer und sonstiges Fachpersonal seien verpflichtet, derartige Behandlungen zu melden und alle, die dieser Meldepflicht nicht nachkommen würden, müssten mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Andere Behörden wären außerdem dazu angehalten, gegen medizinische Institute zu ermitteln, die die missbräuchlichen Behandlungen anbieten.
Auch der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, hatte wenige Tage vor der Anordnung des Gouverneurs erklärt, dass der Einsatz von Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen sowie entsprechende operative Eingriffe nach texanischem Familienrecht als Misshandlung zu klassifizieren seien. Unter derartige Behandlungen zählt der Generalstaatsanwalt in seiner Stellungnahme geschlechtsumwandelnde Operationen, die zur Unfruchtbarkeit führen können, Mastektomien und die Entfernung anderer ansonsten gesunder Körperteile sowie die Gabe von Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen.
IEF-Artikel: https://www.ief.at/gender-modeerscheinung-mit-verheerenden-folgen/
House Bill No. 1570, 2021, Arkansas, An Act to Create the Arkansas Save Adolescents from Experimentation (Safe) Act; and for other purposes
Der US-Bundesstaat Arkansas hat ein Gesetz beschlossen, das geschlechtsangleichende Maßnahmen für Transjugendliche unter 18 Jahren vollständig verbietet. Umfasst sind Behandlungen mit Hormonen und operative Eingriffe. Grund für das Verbot sind klinische Studien, laut denen die Risiken einer Transition den Nutzen überwiegen würden. Außerdem sei die Behandlung unumkehrbar.
Ungarn Verfassungsänderung November 2020
Ungarn hat eine Verfassungsbestimmung verabschiedet, die Kindern das Recht gewährleisten soll, sich mitihrem biologischen Geschlecht zu identifizieren. Außerdem legt die Verfassungsbestimmungen eine Legaldefinition fest, wonach die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann sind.
IEF-Artikel: https://www.ief.at/sorgen-ueber-einfluss-von-transgenderideologie-auf-kinder-wachsen/
Bei Geschlechtsdysphorie, Genderinkongruenz bzw. Transsexualismus empfinden die Betroffenen ein Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit zu ihrem körperlich eindeutigen Geschlecht sowie den gesellschaftlichen Rollenerwartungen. Damit geht meist auch der Wunsch einher, als Angehöriger des anderen Geschlechtes zu leben und anerkannt zu werden. Um das zu erreichen werden häufig chirurgische und hormonelle Behandlungen in Anspruch genommen, um den eigenen Körper dem bevorzugten Geschlecht so weit wie möglich anzugleichen.
In den vergangenen Jahren hat sich die Terminologie rund um „trans*“ vervielfacht. Wenn über Menschen im Kontext von Transsexualität gesprochen wird, reicht die Begriffsvielfalt von trans-gender zu trans-ident, von transsexuellem/r Mann/Frau zu trans*Mann/Frau, über bi-gender, trans*Personen, trans*Eltern, non-binary bis hin zu “Behandlungssuchende”. Dabei soll das Sternchen (*) die Vielfalt der möglichen Geschlechtsidentitäten auch außerhalb der klaren Einteilung in Mann und Frau repräsentieren. Bei der Entwicklung der Begriffe ist die Streichung und fehlende Bezugnahme auf das biologische Geschlecht („sex“) auffallend.
Die Biologie kennt keine Vielzahl der Geschlechter, sondern eine klare Einteilung in zwei Keimzelltypen und somit zwei Geschlechter: „männlich“ und „weiblich“. Was es jedoch gibt, ist eine Vielfalt neuer Merkmalskombinationen, die Produkt der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung ist.
Seit dem 1. Jänner 2022 ist in der ICD-11 nicht mehr von Transsexualismus, sondern von Genderinkongruenz, also einer Nichtübereinstimmung der empfundenen Geschlechtsidentität mit den Geschlechtsmerkmalen des Körpers, die Rede. Außerdem wird die nunmehrige Genderinkongruenz nicht mehr der Kategorie „Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“, sondern den „Problemen/Zuständen im Bereich der sexuellen Gesundheit“ zugeordnet. Differenzialdiagnosen, die im ICD-10 existierten wie „Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechterrollen“, „Sonstige Störung der Geschlechtsidentität“, „Sexuelle Reifungskrise“ oder „Sonstige psychosexuelle Entwicklungsstörung“, sind im ICD-11 ersatzlos gestrichen worden. Eine weitere Veränderung ist, dass der ICD-11 bei Genderinkongruenz als Diagnosekriterium keinen klinisch relevanten Leidensdruck oder die Beeinträchtigung in wichtigen Funktionsbereichen des Betroffenen mehr fordert.
Im amerikanischen Pendant, dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) ist Genderdysphorie weiterhin den psychischen Erkrankungen zugeordnet. Im Gegensatz zum ICD-11 („Genderinkongruenz“) verlangt die Diagnose Genderdysphorie einen Leidensdruck oder die Beeinträchtigung in wichtigen Funktionsbereichen des Betroffenen.
Geschichtlicher Rückblick:
Die Diagnose Transsexualismus tauchte erstmals 1975 in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD, International Classification of Diseases) auf. Das seit 1948 von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene internationale Diagnoseklassifikationssystem wurde schon mehrmals überarbeitet, so auch die Einordnung von Transsexualismus. 1975 wurde Transsexualismus den „Sexuellen Verhaltensabweichungen und Störungen“ zugeordnet. In der 1990 überarbeiteten und bis Dezember 2021 gültigen Version (ICD-10) wurde Transsexualismus als „Störung der Geschlechtsidentität“ bezeichnet und den Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen zugeordnet.
Im DSM wurde der Begriff Transsexualismus erstmals 1980 eingeführt und der Kategorie „Psychosexuelle Störungen“ zugeordnet. 1994 wurde der Begriff Transsexualismus durch „Störung der Geschlechtsidentität“ ersetzt. 2013 entfernte man sich von dem Störungsbegriff und verwendet in der seither gültigen Fassung DSM-5 stattdessen den Begriff „Genderdysphorie“.
Quellen:
https://icd.who.int/en
https://www.bpb.de/themen/gender-diversitaet/geschlechtliche-vielfalt-trans/245353/medizinische-einordnung-von-trans-identitaet/#node-content-title-0
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2022/block-f60-f69.htm
Ziel der Hormonbehandlung ist es, die Hormone des körperlichen Geschlechts zu unterdrücken und die Hormone des Gegengeschlechts zuzuführen. Die Hormone werden in Tablettenform, durch Hormonpflaster oder Depotspritzen verabreicht.
Notwendig für eine Hormonbehandlung ist in Österreich der diagnostische und therapeutische Prozess. Beim diagnostischen Prozess gilt die sogenannte „dreifache Diagnostik“, die psychotherapeutische Diagnostik, die klinisch-psychologische Diagnostik und die psychiatrische Diagnostik. Darauf folgt der therapeutische Prozess, nach dem vor Beginn der Hormonbehandlung eine urologisch-gynäkologische Untersuchung, ein Risiko-Screening hinsichtlich Kontraindikationen und bei Bedarf auch eine zytogenetische Untersuchung durchgeführt werden muss. Zusätzlich bedarf es einer psychotherapeutischen Stellungnahme und einer anschließenden psychiatrischen Kontrolluntersuchung mit Indikationsstellung. Wenn es von keiner Seite Bedenken gibt, kann mit der Therapie begonnen werden, die aus der Einnahme gegengeschlechtlicher Hormone besteht.
Quelle:
Bei Kindern und Jugendlichen:
In den österreichischen Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung werden Hormonbehandlungen in „vollständig reversible Interventionen“ und „partiell reversible Interventionen“ unterschieden. Frühestens können körperliche Interventionen nach dem Informationsgespräch am Ende der diagnostischen Phase nach Pubertätseintritt beginnen.
Vollständig reversible Interventionen können gemäß den Empfehlungen ab einem Pubertätsstadium Tanner 2–3 begonnen werden. Mittels einer pubertätsbremsenden Therapie mit GnRH-Analoga soll „mehr Zeit zur Erkundung der Geschlechtsidentität“ gewonnen und „später unerwünschte Geschlechtsmerkmale“ unterdrückt werden (sog. Pubertätsblockade/-suppression).
Partiell reversible Interventionen werden „ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen, möglichst mit Einverständnis der Obsorgeberechtigten. Im Unterschied zur Hormonbehandlung bei Erwachsenen wird die feminisierende/maskulinisierende Therapie der somatischen und emotionalen Entwicklung angepasst und die Dosis einschleichend im Sinne einer Pubertätsinduktion begonnen und sukzessive gesteigert. Wieder ist auf die nachhaltige Beeinträchtigung bzw. den Verlust der Fertilität hinzuweisen.“
Quelle:
Diese Eingriffe sind schwerwiegend und meist irreversibel. Eine körperliche Geschlechtsanpassung erfordert oft mehr als nur eine Operation. Selbst wenn die geschlechtsangleichende Operation durchgeführt wurde, muss die Hormonbehandlung jedenfalls lebenslang erfolgen. Vor einer solchen Operation braucht es eine Stellungnahme der fallführenden Fachkraft (entweder ein Psychotherapeut oder ein klinischer Psychologe) und eine psychiatrische Kontrolluntersuchung. Danach erfolgt eine Zusammenfassung der beiden Stellungnahmen. Wieder gilt: wenn von keiner Seite Bedenken kommen, kann mit der geschlechtsangleichenden Operation begonnen werden.
Quellen:
Bei Kindern und Jugendlichen:
Gemäß den österreichischen Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung sollen irreversible Interventionen wie Operationen an den Genitalien erst ab Volljährigkeit durchgeführt werden, nachdem die betroffene Person zumindest ein Jahr kontinuierlich in der angestrebten Geschlechtsrolle gelebt hat. Eine Mastektomie kann nach einer angemessenen Zeit des Lebens in der gewünschten Geschlechtsrolle, wobei das Wachstum abgeschlossen sein muss, bereits vor der Volljährigkeit durchgeführt werden (im Falle einer Hormonbehandlung, vorzugsweise nach der Dauer eines Jahres).
Quelle:
Voraussetzungen für die Änderung der Geschlechtseintragung (Personenstandsänderung) für transidente Personen in Österreich:
- Vorhandensein einer „zwanghaften“ Vorstellung im falschen Geschlecht zu leben,
- Vornahme geschlechtskorrigierender Maßnahmen, die eine deutliche Annäherung an das äußere Erscheinungsbild des anderen Geschlechts gewährleisten,
- hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich am Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nichts mehr ändern wird.
Eine geschlechtsumwandende Operation gehört seit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 2008 nicht mehr zu den Voraussetzungen einer Änderung des Geschlechtseintrags.
Standesämter haben unter Berücksichtigung des vom Verwaltungsgerichtshof formulierten Voraussetzungen über Anträge auf Personenstandsänderung zu entscheiden.
Es gibt keine transsexuellen Kinder und Jugendlichen. Bei Kindern und Jugendlichen spricht man von Geschlechtsdysphorie, da die Persönlichkeit sich erst entwickelt. Die „Genderidentität“ ist das Ergebnis des Aufwachsens und kann daher nicht als „angeboren“ bezeichnet werden. Man kann also nicht „im falschen Körper geboren“ sein.
In der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie wird – vorausgesetzt, es findet keine hormonelle Behandlung statt – zwischen „Persistern“ und „Desistern“ unterschieden. „Desister“ sind diejenigen Betroffenen, die die Geschlechtsdysphorie überwinden beziehungsweise integrieren und zu einer hetero- oder homosexuellen Identitätsfindung gelangen. Bei „Persistern“ hingegen mündet die Genderdysphorie im Erwachsenenalter in einer dann so zu bezeichnenden transsexuellen Entwicklung. Es gibt vier aktuelle Studien, die sich mit der Entwicklung der Symptomatik von Genderdysphorie im Rahmen von Follow-Up-Studien beschäftigten. Eine Studie kam zum Ergebnis, dass lediglich 12 Prozent der weiblichen Probanden als „Persister“ und 88 Prozent als „Desister“ zu werten gewesen seien (vgl. DRUMMOND et al., 2008; 2017 Gender Clinic Toronto, CAN). Vier von 25 Mädchen gaben zum Follow-Up-Zeitpunkt eine homosexuelle, zwei von 25 eine bi-sexuelle Orientierung an. Zwei Drittel der Mädchen litten an komorbiden psychiatrischen Störungen. Eine weitere Studie, die Buben untersuchte, kam zu einem ähnlichen Ergebnis. 13,6 Prozent der Buben entwickelten sich zu „Persistern“, während 86 Prozent als „Desister“ lebten (vgl. SINGH, 2012 Gender Clinic Toronto, CAN). Eine niederländische Studie gelangte zu ähnlichen Ergebnissen. Über beide Geschlechter hinweg lag die „Persister“-Rate bei 27 Prozent. Die Mehrzahl der „Desister“ gab zum Zeitpunkt der Follow-Up-Befragung eine homosexuelle Orientierung an (vgl. WALLIEN & COHEN-KETTENIS, 2008 Utrecht Gender Clinic, NL). Eine weitere Studie über beide Geschlechter kam zu einer Rate von 15,8 Prozent „Persistern“ zu 84,2 Prozent „Desistern“ (vgl. STEENSMA & COHEN-KETTENIS, 2008; 2012 Gender Clinic Amsterdam, NL).
Gemäß den österreichischen Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung kann ab einem Pubertätsstadium Tanner 2–3 eine pubertätsbremsende Therapie mit GnRH-Analoga angeboten werden. Die Pubertätsblockade soll dem Jugendlichen mehr Zeit zur Erkundung der Geschlechtsidentität einräumen und später unerwünschte Geschlechtsmerkmale unterdrücken. Die Tanner-Stadien dienen der Stadieneinteilung von körperlichen Entwicklungsmerkmalen während der Pubertät. Sie klassifizieren die Entwicklung der Schambehaarung (Pubarche), der weiblichen Brust (Thelarche) und des männlichen Genitales (Gonadarche). In den Empfehlungen wird die Pubertätsblockade als „vollständig reversible Intervention“ beschrieben, was von vielen Wissenschaftlern und Experten mittlerweile widerlegt wurde (mehr dazu in >> Auswirkungen der hormonellen Pubertätsblockade/-suppression). Von der Pubertätssuppression zu unterscheiden sind die feminisierende/maskulinisierende Therapie mittels Hormone, die ab 16 Jahren empfohlen wird. Im Unterschied zur Hormonbehandlung bei Erwachsenen wird die Therapie der somatischen und emotionalen Entwicklung angepasst und die Dosis einschleichend im Sinne einer Pubertätsinduktion begonnen und sukzessive gesteigert. Die in den österreichischen Empfehlungen als „partiell reversible Intervention“ beschriebene Hormonbehandlung hat die nachhaltige Beeinträchtigung bzw. den Verlust der Fertilität zur Folge.
Auswirkungen der hormonellen Pubertätsblockade/-suppression
Die Pubertätssuppression kann zur Minderung des IQs führen, allerdings sind die Studien zu den Risiken der Pubertätsblockade mit GnRH-Analoga, die als Arzneistoffe zur künstlichen Absenkung des Testosteron- oder Östrogen-Spiegels im Blut eingesetzt werden, spärlich. Eine Fallstudie ist zum Ergebnis gekommen, dass sich das Arbeitsgedächtnis und der Gesamt-IQ (nicht reversibel) signifikant verschlechterte (vgl. SCHNEIDER et al., 2017). Bekannt ist darüber hinaus die Beeinträchtigung der Knochengesundheit. GnRH-Analoga verlangsamen die Zunahme der Knochendichte in der entscheidenden Phase zwischen dem 10. und dem 20. Lebensjahr. Die Knochendichte ist jedoch auch bei transsexuellen Menschen, die gegengeschlechtlich behandelt werden, ohne eine Pubertätsblockade gehabt zu haben, niedriger als bei altersgleichen Kontrollprobanden. Dies zeigt, dass durch künstliche Hormonsubstitution kein ausreichender Aufbau der Knochenmasse erreicht werden kann. Bei Betroffenen, die sowohl eine Pubertätsblockade hatten und bei denen später eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung durchgeführt wird, könnte nicht nur die Summe der negativen Effekte auf die Knochendichte, sondern eine Potenzierung eintreten, befürchten Wissenschaftler. Eine sichere und unbestrittene Folge von GnRH-Analoga im Falle von konsekutiver gegengeschlechtlicher Hormontherapie ist die bleibende Infertilität und damit der Verlust der Reproduktionsfunktion. Eine mögliche und wahrscheinliche Folge von Pubertätssuppression ist außerdem die dauerhafte Beeinträchtigung der sexuellen Erlebnisfähigkeit. Zusammenfassend gehen Wissenschaftler davon aus, dass die pubertätsblockierende Behandlung von Genderdysphorie in Kindheit und Frühadoleszenz faktisch immer irreversible konträrgeschlechtlich-hormonelle und chirurgische Maßnahmen nach sich zieht, wodurch sie den Betroffenen die Möglichkeit einer Überwindung der Geschlechtsdysphorie nimmt. Gegen die Pubertätsblockade spricht außerdem die fehlende emotional-kognitive Reife des Kindes sowie die möglichen physischen, kognitiven und psychiatrischen Nebenwirkungen. Gleichzeitig beeinflussen GnRH-Analoge und Antiandrogene das sexuelle Erleben und verunmöglichen eine altersgerechte sozio-sexuelle Entwicklung. Das schließt wiederum die Gelegenheit aus, Erfahrungen für eine homosexuelle Identitätsfindung zu machen.
(Dr. Alexander Korte: https://www.ief.at/at_de-gender-psychiater-plaediert-fuer-ergebnisoffene-und-gender-kritische-psychotherapie-bei-geschlechtsdysphorie/)
In den letzten Jahren konnte ein enormer Prävalenzanstieg von Genderdysphorie bei Kindern und Jugendlichen festgestellt werden. Die mittlerweile geschlossene britische Tavistock-Klinik hatte zwischen 2009 und 2018 einen Anstieg von registrierten und behandelten Minderjährigen um rund 4500 Prozent, mit einem Mädchenanteil von zuletzt fast 80 Prozent, verzeichnet. Der Anstieg insgesamt und die Frage, warum sich die Sex-Ratio, also das zahlenmäßige Verhältnis der betroffenen Geschlechter, verändert hat, ist bisher weitgehend ungeklärt (vgl. Aiken et al., 2015). Mit der veränderten Sex-Ratio beschäftigte sich die amerikanische Ärztin Lisa Littmann in einer Studie aus dem Jahr 2018 und kam zum Ergebnis, dass „das Unbehagen mit dem eigenen Körper“ nicht die eigentliche Ursache für Genderdysphorie sein könnte. Es zeigte sich vielmehr, dass bei 62,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die ein plötzliches trans-Outing in der Adoleszenz hatten („rapid-onset gender dysphoria“), bereits psychische Störungen wie Depressionen oder neurologische Entwicklungsstörungen wie Autismus diagnostiziert worden waren.
Erklärungsversuche
In der Psychiatrie hinlänglich bekannt ist die Tatsache, dass aufgrund des größeren „reproduktiven Investments“ von Frauen die psychische Integration des zur Reife gelangten Genital- und vor allem Reproduktionsapparats für weibliche Jugendliche deutlich schwerer ist als für männliche Jugendliche (sog. „Parental Investment Theory“, TRIVERS, 1972). Während 33 Prozent der Mädchen die Menarche als unangenehm und weitere 22 Prozent als ambivalent empfinden, haben nur 4 Prozent der Buben unangenehme Assoziationen im Zusammenhang mit Pubertät (vgl. eine Studie zum Sexualverhalten Jugendlicher von KLUGE, 1998). Der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Alexander Korte hält es daher für möglich, dass es sich vielmehr um einen Altersrollen- als um einen Geschlechtsidentitätskonflikt handeln könnte. Genderdysphorie bei Mädchen könne möglicherweise als Entwicklungskonflikt gedeutet werden, bei dem eine Diskrepanz zwischen mentaler, sozio-emotionaler und psycho-sexueller Entwicklung im Gegensatz zur körperlich-sexuellen Entwicklung entstehe.
Für Korte stellt sich die Frage, ob „trans*“ den Betroffenen nicht vielleicht als Identifikationsschablone diene. Seien Ende der 90er Jahre die Diagnosen „Borderliner“ oder „Multiple Persönlichkeit“ in Mode gewesen, bei der ebenso besonders weibliche Teenager betroffen gewesen seien, so gebe es heute einen „trans*-Boom“. „Trans*“ und ähnliche Kategorisierungen funktionierten auch als Sinnangebote, so Korte: „Sie geben den Jugendlichen die Möglichkeit, ihrem individuellen Leiden in einer zu ihrer Zeit und in ihrer Kultur akzeptierten Form Ausdruck zu verleihen.“ Gleichzeitig stelle die Kategorisierung Aufmerksamkeit, den Status des Besonderen und des Außergewöhnlichen in Aussicht. Laut Korte sei Genderdysphorie zwar keine Modeerscheinung, aber ein Zeitgeistphänomen. „Soziale Ansteckung“ halte er daher für möglich. In diesem Zusammenhang verweist der Mediziner darauf, dass psychiatrische Erkrankungen nicht einfach „da sind“, sondern Diagnosen und Klassifikationssysteme „gemacht“ werden (siehe Entwicklung der Medizinischen Einordnung).
Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie bzw. Transsexualismus nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung (ab Volljährigkeit) – Österreich, Stand 20.06.2017 (zum Download)
Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung – Österreich, Stand 14.12.2017 (zum Download)
World Professional Association for Transgender Health (WPATH) Standards of Care (zum Download)
Standards der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen – Deutschland (zum Download)
Von der Transsexualität zur Gender-Dysphorie – Schweiz (zum Download)
Korrelation zwischen Peer Group, Social Media und Geschlechtsdysphorie
Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria, Lisa Littman, 2018, PLOS ONE 13(8): e0202330
Lisa Littman, Soziologin an der Brown University, Rhode Island (US) untersuchte in ihrer Studie Aussagen von Eltern, die beobachteten, dass ihre Kinder plötzliche Anzeichen von Geschlechtsdysphorie, also dem Empfinden im falschen Geschlechts zu sein, aufwiesen. Eltern beschrieben, dass dies oft nicht nur bei einem Jugendlichen auftrat, sondern dieses Phänomen zeitgleich auch bei weiteren Jugendlichen im Freundeskreis beobachtet wurde. Eltern berichteten in Littmans Erhebungen außerdem, dass sie kurz vor dem Anstieg der Anzeichen für eine Geschlechtsdysphorie einen verstärkten Gebrauch von Social Media bei den Jugendlichen wahrgenommen hatten. Daraus schloss Littmann, dass sowohl Freunde aus der Peer Group als auch Social Media Einflüsse auf das oft plötzlich und stark aufkommende Gefühl, im falschen Geschlechtskörper zu sein, haben.
Die Studienergebnisse riefen Proteste von Transgender-Aktivisten hervor – das führte zu einer Überarbeitung der Studie, das Ergebnis blieb aber gleich.
Überarbeitete Studie: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214157
IEF-Artikel: https://www.ief.at/usa-gender-studie-bestaetigt-zusammenhang-zwischen-social-media-konsum-und-steigendem-transgender-empfinden/
Psychische Erkrankungen und erhöhtes Risiko für Geschlechtsdysphorie
Attachment Patterns in Children and Adolescents With Gender Dysphoria, Kasia Kozlowska et al., 2021, Frontiers in Psychology, Volume 11 – 2020
Die australische Studie aus 2021 zeigt, dass die Gefahr für Kinder und Jugendliche, an Genderdysphorie zu erkranken höher ist, wenn sie unter einer psychischen Erkrankung leiden oder einen Verlust oder ein Trauma erlebt haben.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.582688/full
Erhöhte Sterblichkeitsrate nach Hormonbehandlung
A long-term follow-up study of mortality in transsexuals receiving treatment with cross-sex hormones, Henk Asscheman, 2011, Eur J Endocrinol. 164(4):635-42. doi: 10.1530/EJE-10-1038.
Bei Männern, die eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen, zeigt sich eine um 51 Prozent erhöhte Sterblichkeitsrate im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung (Selbstmord, Drogenmissbrauch, kardiovaskuläre Erkrankungen, AIDS).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21266549/
Erhöhte Suizidrate nach einer geschlechtsumwandelnden Operation
Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden, Cecilia Dhejne et al., 2011, PLoS ONE 6(2): e16885.
Personen nach einer geschlechtsumwandelnden Operation begehen 7,6-mal häufiger Selbstmordversuche als eine Kontrollgruppe und diese Versuche enden 19-mal häufiger tödlich.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885
Erhöhte Suizidalität nach einer der geschlechtsumwandelnden Operation
Varied Reports of Adult Transgender Suicidality: Synthesizing and Describing the Peer-Reviewed and Gray Literature, Noah Adams et al., Transgender Health 2017 2:1, 60-75
Suizidphantasien und Selbstmordversuche von Menschen mit Geschlechtsidentitätsstörungen sind im Jahr nach der geschlechtsumwandelnden Operation mit 50,6 Prozent deutlich höher als vor der Operation mit 36,1 Prozent.
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/trgh.2016.0036
Suizidversuche von Transgenderpersonen
Haas, A. P., Rodgers, P. L., Herman, J. L. (2014). Suicide attempts among transgender and gender non-conforming adults, American Foundation for Suicide Prevention and The Williams Institute
Die Prävalenz von Suizidversuchen beträgt unter Transmännern 46 Prozent und unter Transfrauen 42 Prozent, während lediglich 4,6 Prozent der gesamten US-Bevölkerung angaben, in ihrem Leben einen Suizidversuch unternommen zu haben.
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Trans-GNC-Suicide-Attempts-Jan-2014.pdf
<h5″>Einsatz von Pubertätsblockern ist „experimentell“ und kann irreversible Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern haben
A systematic review of hormone treatment for children with gender dysphoria and recommendations for research, J. F. Ludvigsson, J. Adolfsson et al. , Acta Paediatrica April 2023
Für die systematische Übersicht bewerteten die Forscher mehr als 9900 Abstracts aus fünfzehn wissenschaftlichen Datenbanken und identifizierten 24 relevante Studien. Sie kamen zum Ergebnis, dass die Behandlung mit GnRHa irreversible Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern haben könnten, wie eine verminderte Knochendichte sowie die Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit. Die Forscher zogen außerdem den Schluss, dass die Evidenz zur Beurteilung der Auswirkungen einer Hormonbehandlung auf die Bereiche psychosoziale Auswirkungen, Knochengesundheit, Körperzusammensetzung und Stoffwechsel sowie Therapiepersistenz bei Minderjährigen mit Geschlechtsdysphorie unzureichend sei.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16791
IEF-Artikel: https://www.ief.at/se_int-gender-schwedische-wissenschaftler-warnen-vor-dem-standardmaessigen-einsatz-von-pubertaetsblockern/
Honeymoon-Effekt nach einer geschlechtsumwandelnden Operation
Quality of life improves early after gender reassignment surgery in transgender women, Ebba K. Lindqvist et al., 2017, Eur J Plast Surg 40, 223–226
Die Studie fand heraus, dass es einen Honeymoon-Effekt kurz nach einer geschlechtsumwandelnden Operation gibt, die Lebensqualität von betroffenen Menschen im Vergleich allerdings immer noch ein niedrigeres Niveau aufweist. Die Zufriedenheit betroffener Personen beginnt nachweislich nach 3 Jahren zu sinken.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00238-016-1252-0
Schlechteres IQ durch Pubertätsblocker
Brain Maturation, Cognition and Voice Pattern in a Gender Dysphoria Case under Pubertal Suppression, Maiko A. Schneider et al., 2017, Frontiers in Human Neuroscience Volume 11
Die Fallstudie kommt zum Ergebnis, dass sich das Arbeitsgedächtnis und der Gesamt-IQ durch die Hormonbehandlung im Zuge einer Pubertätsblockade signifikant und nicht reversibel verschlechterte.
https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00528
Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie
The Treatment of Gender Identity (Gender Dysphoria) Disorders in Childhood and Adolescence – Open-Outcome Psychotherapeutic Support or Early Setting of Therapy Course with the Introduction of Hormonal Therapy?, Alexander Korte et al., 2016, Sexuologie 23 (3-4) (1):117-132
Der Fachartikel setzt sich mit der Frage auseinander, ob eine ausgangsoffene psychotherapeutische Begleitung oder frühzeitige Festlegung und Weichenstellung durch Einleitung einer hormonellen Therapie bei Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsidentitätsstörungen als Behandlung eingesetzt werden soll.
Risikoreiche Geschlechtsumwandlung mit körpereigenem Gewebe
Lethal Necrotizing Cellulitis Caused by ESBL-Producing E. Coli after Laparoscopic Intestinal Vaginoplasty,
Ein 18-jähriger Teenager unterzog sich einer geschlechtsumwandelnden Operation. Die Ärzte versuchten, anhand von dessen Dickdarmgewebe eine Vagina nachzubilden. Der Teenager erlitt daraufhin einen septischen Schock und mehrere Organversagen, die schließlich zu seinem Tod führten.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27664856/
Follow-Up Studien zum weiteren Verlauf der Genderdysphorie (Nachuntersuchung von Personen – in dem Fall mit Genderdysphorie – die zu einem früheren Zeitpunkt bereits untersucht wurden)
A follow-up study of girls with gender identity disorder, Kelley D. Drummond, Susan J. Bradley et al., Jan 2008, Developmental psychology 44(1):34-45. doi: 10.1037/0012-1649.44.1.34.
Die Studie kam zum Ergebnis, dass lediglich 12 Prozent der weiblichen Probanden als „Persister“ und 88 Prozent als „Desister“ zu werten gewesen seien. Vier von 25 Mädchen gaben zum Follow-Up-Zeitpunkt eine homosexuelle, zwei von 25 eine bi-sexuelle Orientierung an. Zwei Drittel der Mädchen litten an komorbiden psychiatrischen Störungen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18194003/
Erwähnt in IEF-Artikel: https://www.ief.at/at_de-gender-psychiater-plaediert-fuer-ergebnisoffene-und-gender-kritische-psychotherapie-bei-geschlechtsdysphorie/
A Follow-Up Study of Boys With Gender Identity Disorder, Devita Singh, 2012, Department of Human Development and Applied Psychology, University of Toronto
Die Studie untersuchte den weiteren Verlauf von Genderdysphorie bei Buben und kam zum Ergebnis, dass 13,6 Prozent der Buben sich zu „Persistern“ entwickelten, während 86 Prozent als „Desister“ lebten.
Book-Preview: https://www.proquest.com/openview/264c217707b1f9a739006f66303c01f8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
Erwähnt in IEF-Artikel: https://www.ief.at/at_de-gender-psychiater-plaediert-fuer-ergebnisoffene-und-gender-kritische-psychotherapie-bei-geschlechtsdysphorie/
A Follow-Up Study of Boys With Gender Identity Disorder, Devita Singh, Susan J. Bradley et al., Front. Psychiatry, 29 March 2021, Sec. Public Mental Health Volume 12 – 2021
Die Studie untersuchte den weiteren Verlauf von Genderdysphorie bei Buben und kam zum Ergebnis, dass 12 Prozent als “Persister” lebten.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.632784/full
Psychosexual outcome of gender-dysphoric children, Madeleine S. C. Wallien und Peggy T. Cohen-Kettenis, 2008, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2008 Dec, 47(12):1413-23
Die Studie untersuchte den weiteren Verlauf von Genderdysphorie beider Geschlechter. Über beide Geschlechter hinweg lag die „Persister“-Rate bei 27 Prozent. Die Mehrzahl der „Desister“ gab zum Zeitpunkt der Follow-Up-Befragung eine homosexuelle Orientierung an.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18981931/
Erwähnt in IEF-Artikel: https://www.ief.at/at_de-gender-psychiater-plaediert-fuer-ergebnisoffene-und-gender-kritische-psychotherapie-bei-geschlechtsdysphorie/
Systemische Fehler in Studien und Artikeln zur Lebensqualität von Transgender-Personen
Nobili, A., Glazebrook, C. & Arcelus, J. Quality of life of treatment-seeking transgender adults: A systematic review and meta-analysis. Rev Endocr Metab Disord 19, 199–220 (2018)
Bei der Untersuchung von Studien und Artikeln zur Lebensqualität von Menschen mit einer Geschlechtsidentitätsstörung stellte man fest, dass bei fast allen Artikeln und Studien systematische Fehler bestehen (einmalig durchgeführte Befragungen, fehlende Kontrollgruppen, hohes Verzerrungspotential). Nur zwei Studien wurden als hochwertig bewertet. Bei anderen gab es vermehrt zu kurze Laufzeiten und viele Studienteilnehmer verließen die Studien vorzeitig.
https://doi.org/10.1007/s11154-018-9459-y
Korrelation zwischen Studienqualität und Teilnehmerabbruchquote
Loss to Follow-Up in Cohort Studies: How Much is Too Much?, Vicki Kristman und Pierre Côté, 2004, European Journal of Epidemiology 19(8):751-60
Vicki Kristman stellte in ihrer Studie klar, dass eine Teilnehmerabbruchquote von über 20 Prozent bei Studien zu einer Einschränkung der Verlässlichkeit der jeweiligen Studienergebnisse führt. Diese Studie ist unabhängig von der Transgenderthematik durchgeführt worden, ist aber von hoher Bedeutung, wenn man sich Studien zum Leben von Transgenderpersonen ansieht.
Teilnahemabbruch nach Komplikationen
Loss to Follow-up Matters, D.W. Murray, A. R. Britton und C. J. K. Bulstrode, 1997, British Editorial Society of Bone and Joint Surgery 0301-620X/97/26975
Die Studie stellt fest, dass jene Teilnehmer für eine Studie verlorengehen, bei denen während des Studienverlaufs nach einer medizinischen Maßnahme schwerwiegende Probleme auftreten.
https://online.boneandjoint.org.uk/doi/pdf/10.1302/0301-620X.79B2.0790254
Studienkritik
Long-Term Follow-Up of Adults with Gender Identity Disorder, Friedemann Pfäfflin und Ulrike Ruppin, 2015, Archives of Sexual Behavior volume 44, pages 1321–1329
Die Studie, die der Geschlechtsumwandlung viele positive Langzeitfolgen zuschreibt, wirft viele Fragen über ihre Aussagekraft auf. 49,3 Prozent der Teilnehmer sind im Verlauf der Studie weggefallen, was laut der Studie von D.W. Murray darauf hindeuten würde, dass bei ihnen nach einer Geschlechtsumwandlung gesundheitliche Komplikationen aufregten sind. Außerdem liefert die Studie keine zuverlässigen Ergebnisse, da sie eine Teilnehmerabbruchrate von über 20 Prozent ausfweist (siehe Studie von Vicki Kristman 2004).
Österreich
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 27. Februar 2009, 2008/17/0054
Der Verwaltungsgerichtshof hat in dem Urteil entschieden, “dass ein schwerwiegender operativer Eingriff, wie etwa die von der belangten Behörde geforderte Entfernung der primären Geschlechtsmerkmale, keine notwendige Voraussetzung für eine deutliche Annäherung an das äußere Erscheinungsbild des anderen Geschlechts ist.”
Das Gericht formulierte daraufhin die Voraussetzungen nach welchen die Personenstandsbehörde die Beurkundung des Geschlechts im Personenstandsregister zu ändern hat: “In Fällen, in denen eine Person unter der zwanghaften Vorstellung gelebt hat, dem anderen Geschlecht zuzugehören, und sich geschlechtskorrigierender Maßnahmen unterzogen hat, die zu einer deutlichen Annäherung an das äußere Erscheinungsbild des anderen Geschlechts geführt haben, und bei der mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass sich am Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nichts mehr ändern wird.”
EGMR-Entscheidungen
O.H. und G.H. gegen Deutschland / A.H. und andere gegen Deutschland, April 2023
In einem der beiden Fälle hatte eine Trans-Frau unter Berufung auf das Recht auf Achtung des gefordert, als Mutter des mit ihrem Samen gezeugten Kindes amtlich eingetragen zu werden. Das zuständige Standesamt entschied, die als Mann geborene Klägerin nicht als Mutter in das Geburtenregister einzutragen, da sie das Kind nicht geboren habe. Stattdessen wird jene Person als Mutter geführt, die das Kind tatsächlich zur Welt gebracht hat. Beide Elternteile klagten gegen dieses Vorgehen. Im zweiten Fall ging es um die Beschwerde eines Trans-Mannes, der als „Vater“ seines Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen werden wollte. Der Kläger war als Frau geboren worden und hatte das Kind zur Welt gebracht, nachdem der Geschlechtswechsel von weiblich zu männlich bereits rechtlich anerkannt worden war. Zweitantragsteller im Verfahren war das geborene Kind.
EGMR entschied, dass es rechtens ist, die biologische Vater- oder Mutterschaft ins Geburtenregister einzutragen, auch wenn der Elternteil vor oder nach der Geburt die Geschlechtsidentität gewechselt habe. Rechtens ist auch die Eintragung der Elternteile mit den ursprünglichen Vornamen. Die Deutschen Gerichte hätten einen fairen Ausgleich zwischen den Rechten der Beschwerdeführer, den Kindeswohlerwägungen und dem öffentlichen Interessens gefunden.
X. und Y. gegen Rumänen, 19.01.2021
Die Kläger versuchten eine Änderung ihres Geschlechtseintrags von „weiblich“ auf „männlich“ vor den nationalen Gerichten zu erwirken. Diese lehnten die Anträge mit der Begründung ab, dass sie „verfrüht“ seien und forderten die Antragsteller auf, eine Bestätigung über eine geschlechtsumwandelnde Operation vorzulegen.
Der EGRM sah darin eine Verletzung von Artikel 8. Das nationale Recht in Rumänien sehe kein etabliertes Verfahren zur Änderung der Geschlechtsidentität vor. Die Möglichkeit, das Geschlecht vor den nationalen Gerichten ändern zu lassen, wurde zwar vom rumänischen Verfassungsgerichtshof im Jahr 2008 anerkannt. Damit sei auch eine rechtliche Basis zur Änderung des Geschlechts in Rumänien vorhanden. Diese sei jedoch in Bezug auf die Voraussetzungen, die für eine Änderung der Geschlechtsidentität zu erfüllen seien, nach Ansicht des Gerichtshofs zu vage und unbestimmt. Die nationalen Gerichte hätten dabei, keine triftigen Gründe für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses, das der Änderung des Geschlechtseintrags im konkreten Fall entgegenstünde, vorgebracht und auch keine adäquate Interessensabwägung zwischen einem wie auch immer gearteten öffentlichem Interesse und dem Recht der Kläger auf Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität vorgenommen. Aufgrund des Fehlens von klaren und vorhersehbaren Verfahren, die eine rasche, transparente und leicht zugängliche Änderung des Namens und der Geschlechtseintragung in offiziellen Dokumenten ermöglichen würden, habe Rumänien im gegenständlichen Fall gegen Artikel 8 EMRK verstoßen.
Großbritannien
Bell v Tavistock Dezember 2020 – Klage gegen britische Tavistock Klinik aufgrund von überstürzter Diagnose von Geschlechtsdysphorie und Behandlung
Urteil: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/12/Bell-v-Tavistock-Judgment.pdf
Die Diagnose “Geschlechtsdysphorie” wird teilweise nach nur 3 Sitzungen gestellt und anschließend wird mit der Behandlung begonnen. Die Betroffene wurde nicht auf das Vorhandensein anderer psychischer Probleme hin untersucht. Die Geschlechtsumwandlung führte auch nicht zu einer Verbesserung ihrer Situation. Sie kämpfte mit Selbstmordgedanken und wollte wieder in ihrem biologischen Geschlecht leben. Sie reichte Klage gegen die britische Tavistock Klinik ein. Das Gericht gab der Klage des Mädchens statt. Der High Court sagte, dass Minderjährige nicht in der Lage sind die weitreichenden Folgen des Einsatzes von Pubertätsblockern zu erfassen und daher eine Transgenderbehandlung für Minderjährige unzulässig sei.
IEF-Artikel: https://www.ief.at/high-court-verbietet-behandlung-von-kindern-mit-pubertaetsblockern/
Kanada
Supreme Court of British Columbia Judgement Transgender Boy against father April 2019
https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/19/06/2019BCSC0604.htm
Ein Mädchen hat in der Schule ohne das Wissen ihrer Eltern Informationen zur Transgenderbehandlung bekommen und wollte daraufhin ein Junge werden. Der Vater versuchte, die Behandlung seiner Tochter gerichtlich zu verhindern, das Gericht erlaubte jedoch die Behandlung und ordnete an, dass der Vater das Mädchen mit dem männlichen Pronomen anzusprechen habe.
Court of Appeal for British Columbia Judgement Transgender Boy against father Jänner 2020
http://www.westcoastleaf.org/wp-content/uploads/2020/01/A.B.-decision-January-2020bcca11.pdf
Das Urteil des Supreme Courts of British Columbia wurde durch den Court of Appeal von British Columbia bestätigt. Der Vater kann es nicht verhindern, dass seine Tochter Hormonspritzen von den Ärzten bekommt. Er muss das Mädchen auch mit männlichem Pronomen bezeichnen und darf in den Medien nichtmehr über den Fall reden. Allerdings stellt sein Verhalten keine, wie im Urteil des Supreme Courts behauptete, familiäre Gewalt dar. Der Vater in Kanada ist nun verhaftet worden, weil er den Anordnungen des Gerichts nicht gehorcht hat und er seine 15-jährige Tochter als Mädchen anredete, obwohl sie mit dem männlichen Pronomen angesprochen werden wollte.
Richtlinie der des Schwedischen Karolinska Universitätskrankenhauses zur Aussetzung von Gender-Behandlungen bei Kindern, 2021 „Guideline Regarding Hormonal Treatment of Minors with Gender Dysphoria at Tema Barn – Astrid Lindgren Children’s Hospital (ALB)“
Die Klinik verweist in der Richtlinie unter anderem auf die Publikation der SBU (Swedish Agency for Health Technology of Social Services), in der zum einen auf die fehlenden Nachweise der Langzeiteffekte und zum anderen auf die Gründe für die starke Zunahme an Patienten in den letzten Jahren hingewiesen wurde. Darüber hinaus verwiest sie auf eine Studie des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) über den nicht nachweisbaren Nutzen einer Behandlung mit Pubertätsblockern und der gegengeschlechtlichen Hormontherapie.
IEF-Artikel: https://www.ief.at/se-gender-schwedisches-universitaetskrankenhaus-beendet-gender-behandlung-bei-kindern/
Publikation der Swedish agency for Health Technology of Social Services, 2019, “Gender dysphoria in children and adolescents: an inventory of the literature”
Die SBU weist auf die fehlenden Nachweise der Langzeiteffekte und auf die Gründe für die starke Zunahme an Patienten in den letzten Jahren hin.
Pressemitteilung, 2022, Warnung der französischen Nationalen Akademie der Medizin vor übereilten unumkehrbaren Transgender-Behandlungen
In Frankreich ist der Einsatz von Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen mit der Zustimmung der Eltern ohne Altersbeschränkung möglich. Chirurgische Eingriffe, vor allem Brustamputationen und Operationen an den externen Geschlechtsorganen sind ab 14 Jahren erlaubt. 2022 warnte die französische Nationale Akademie der Medizin in einer Presseaussendung davor, Kinder und Jugendliche, die ihr biologisches Geschlecht in Frage stellen, vorschnell mit gesundheitsschädlichen und unwiderruflichen Therapien zu behandeln. Auch wenn die Gründe für den Anstieg vielfältig sein mögen und von sozialer Akzeptanz bis Peer Pressure reichen können, sieht die Akademie in der Transidentität bei Kindern und Jugendlichen vor allem ein soziales Problem. Fälle und manchmal gar Cluster von Genderdysphorie würden oft in unmittelbarer Nähe auftreten.
Ein neues Gesetz des US-Bundesstaates Idaho verbietet künftig Geschlechtsumwandlungen bei Kindern unter 18 Jahren. Vom Verbot umfasst sind die Behandlung mit Pubertätsblockern, also Medikamenten, die die Bildung von Geschlechtshormonen stoppen, sowie chemische Kastrationen und Masektomien (Brustentfernungen) bei unter 18-Jährigen.
Anordnung des texanischen Gouverneurs Abbott an das Familienministerium, 2022
Der texanische Gouverneur, Greg Abbott, ordnete Ende Februar an, dass das Familienministerium Untersuchungen bei Ärzten und Eltern von Kindern, an denen Hormonbehandlungen oder geschlechtsumwandelnde Operation durchgeführt wurden, einleite. Auch Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer und sonstiges Fachpersonal seien verpflichtet, derartige Behandlungen zu melden und alle, die dieser Meldepflicht nicht nachkommen würden, müssten mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Andere Behörden wären außerdem dazu angehalten, gegen medizinische Institute zu ermitteln, die die missbräuchlichen Behandlungen anbieten.
Auch der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, hatte wenige Tage vor der Anordnung des Gouverneurs erklärt, dass der Einsatz von Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen sowie entsprechende operative Eingriffe nach texanischem Familienrecht als Misshandlung zu klassifizieren seien. Unter derartige Behandlungen zählt der Generalstaatsanwalt in seiner Stellungnahme geschlechtsumwandelnde Operationen, die zur Unfruchtbarkeit führen können, Mastektomien und die Entfernung anderer ansonsten gesunder Körperteile sowie die Gabe von Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen.
IEF-Artikel: https://www.ief.at/gender-modeerscheinung-mit-verheerenden-folgen/
House Bill No. 1570, 2021, Arkansas, An Act to Create the Arkansas Save Adolescents from Experimentation (Safe) Act; and for other purposes
Der US-Bundesstaat Arkansas hat ein Gesetz beschlossen, das geschlechtsangleichende Maßnahmen für Transjugendliche unter 18 Jahren vollständig verbietet. Umfasst sind Behandlungen mit Hormonen und operative Eingriffe. Grund für das Verbot sind klinische Studien, laut denen die Risiken einer Transition den Nutzen überwiegen würden. Außerdem sei die Behandlung unumkehrbar.
Ungarn Verfassungsänderung November 2020
Ungarn hat eine Verfassungsbestimmung verabschiedet, die Kindern das Recht gewährleisten soll, sich mitihrem biologischen Geschlecht zu identifizieren. Außerdem legt die Verfassungsbestimmungen eine Legaldefinition fest, wonach die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann sind.
IEF-Artikel: https://www.ief.at/sorgen-ueber-einfluss-von-transgenderideologie-auf-kinder-wachsen/