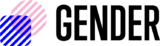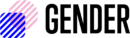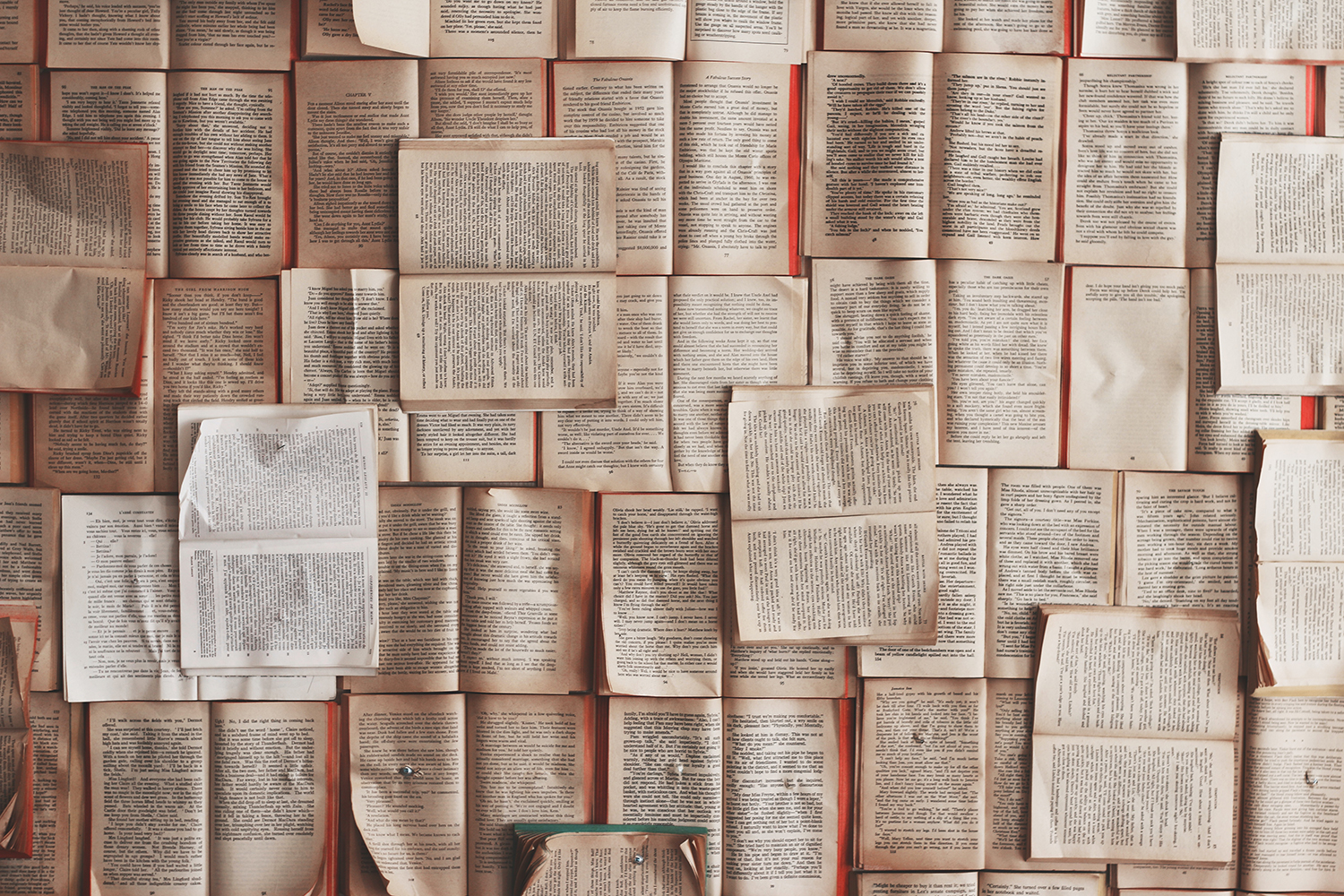Frauen begannen im 19. Jahrhundert gegen die Vorherrschaft des Mannes zu rebellieren. Die Produktionsverhältnisse hatten sich verändert, wodurch sich auch die Rolle der Frau innerhalb der Familie veränderte. Bis ins 20. Jahrhundert hinein durften Frauen beispielsweise nicht auf höhere Schulen oder Universitäten gehen, nicht wählen, kein Bankkonto eröffnen, nur selten einen Beruf ausüben und keine öffentlichen Ämter oder Führungspositionen bekleiden. Zunächst forderten Frauen aus der gebildeten Mittelschicht gleiche Rechte wie die Männer. Sie kämpften insbesondere für politische Rechte, Bildungsrechte und bessere soziale Verhältnisse. Organisiert in christlichen Frauenvereinen setzten sie sich für den Schutz von Müttern und Familien ein. Ihre Forderungen sind in der westlichen Welt heute weitgehend erfüllt.
Parallel dazu entwickelte sich der kommunistische Widerstand gegen den Frühkapitalismus, als deren Vertreter Karl Marx (1818-1883) und Friedrich Engels (1820-1895) bekannt sind. Diese griffen das Gleichberechtigungsthema auf und deuteten es in eine Klassenfrage um. Engels bezeichnete die Unterdrückung des weiblichen Geschlechts durch das männliche im Rahmen der Einzelehe als erste Klassenunterdrückung. Er forderte deshalb die Abschaffung der Familie, die gleichartige Eingliederung von Mann und Frau in den Arbeitsprozess sowie die öffentliche Kindererziehung.
Eine wesentliche Zäsur in der Entwicklung des Feminismus stellte die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir (1908–1986) dar. Von ihr stammt die folgenschwere Aussage: „Man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht.“ Ihren Kampf um die „sexuelle Selbstbestimmung“ der Frau legte sie in ihrem Werk „Das andere Geschlecht (1949)“ dar. Sie propagierte die Legalisierung von Verhütung und Abtreibung als Mittel zur Emanzipation der Frau. Simone de Beauvoir und gleichgesinnte Feministinnen wollten mehr Gleichberechtigung für die Frauen erreichen und stellten sich dabei gegen die Ehe, die Familie sowie das Kind und traten für die vollständige Deregulierung der Sexualität ein.
Auf männlicher Seite war Magnus Hirschfeld (1868-1935) einer der ersten Aktivisten, der für die Legitimierung der Homosexualität eintrat. Er gilt als „Pionier der Sexualwissenschaft“ und entwickelte die Theorie, dass die binäre Geschlechterordnung zugunsten einer radikalen Individualisierung aufgelöst werden müsse. Seine politische Agenda veröffentlichte er als wissenschaftliche Theorie und behauptete, dass jeder Mann und jede Frau eine einzigartige Mischung männlicher und weiblicher Anteile sei. Hirschfeld kämpfte einerseits für die Akzeptanz der Homosexualität, andererseits ging er davon aus, dass Homosexualität eine „angeborene Missbildung“ sei. Er bezeichnete homosexuelle Männer und Frauen als „Unglückliche, Entrechtete, die den Fluch eines geheimnisvollen Rätsels der Natur durch ihr einsames Leben schleppen“. Und weiter: „Jedem Arzt, der neue Behandlungsmöglichkeiten aufweist, müssen wir dankbar sein, da vielen Homosexuellen der gewiss berechtigte Wunsch innewohnt, heterosexuell zu sein.“ Hirschfeld gründete 1908 die „Zeitschrift für Sexualwissenschaft“ und 1919 das „Institut für Sexualwissenschaft“, das in Europas Hauptstädten Kongresse für „Sexualreformen auf wissenschaftlicher Grundlage“ organisierte. 1923 gründete er das „Institut für Freikörperkultur“ und 1928 die „Weltliga für Sexualreform“, womit er die Grundlage für die internationale Vernetzung von Homosexuellen-Bewegungen legte. Außerdem erkannte er das Potential der Medien und initiierte die Produktion des Films „Anders als die Anderen“, bei dem er selbst mitwirkte. Auf seinen Grabstein in Nizza ist sein Leitmotto graviert: „Per scientiam ad iustitia“ („Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit“). Das Vermächtnis von Hirschfeld wirkt weiter, etwa indem die 1990 gegründete deutsche „Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung“ die Magnus-Hirschfeld-Medaille für besondere Verdienste um Sexualwissenschaft und Sexualreform verleiht oder in der 2011 mit 10 Millionen errichteten deutschen „Bundesstiftung Magnus Hirschfeld“.
Um „Zwangsehe“ und „Zwangsfamilie als Erziehungsapparat“ zu eliminieren und im Rahmen der „Orgasmustheorie“ gesund zu bleiben, setzte der Schüler Sigmund Freuds (1856-1939), Wilhelm Reich (1897-1957), auf die Sexualisierung der Massen und der Kinder. Dadurch wollte er nach eigenen Worten „die infantilen Bindungen an die Eltern und damit die sexuelle Repression“ auflösen. Reich ging davon aus, dass die Sexualisierung des Menschen seine Beziehungen zu Autoritäten zerstöre. Dies wiederum sei ein notwendiger Schritt, um „frei“ zu werden. Reich behauptete, dass der Mensch glücklich werde, wenn er seine sexuellen Bedürfnisse ohne jede Einschränkung befriedigen könne. Neben Massenveranstaltungen, die er für Erwachsene organisierte, versuchte er Kinder und Jugendliche von der „sexualverneinenden und -verleugnenden Erziehung“ zu befreien und sie durch Sexualisierung aus dem Familienverband zu lösen. Wissenschaftlich untermauerte er seine Thesen mit der Psychoanalyse. Weil er einen Apparat zur Produktion von „Lebensenergie“ erfand und verkaufte, wurde er wegen Betrug zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er starb 1957 im Zuchthaus Lewisburg. Seine Theorien wurden später teilweise von Adorno, Horkheimer und Marcuse im Rahmen der „Frankfurter Schule“ übernommen und durch die 68er-Revolution weitergegeben.
Hatte Hirschfeld Anfang des 20. Jahrhunderts den theoretischen Grundstein für die Gender Theorie gelegt, setzte der Psychiater John Money (1921-2006) diese in die medizinische Praxis um. In den 1960er Jahren eröffnete er die erste Klinik für operative Geschlechtsumwandlung, die Gender Identity Clinic, in Baltimore/USA. Money führte die Begriffe „Geschlechtsidentität“ („gender identity“) und „Geschlechterrolle“ („gender role“) ein. Bis heute wird er zu den einflussreichsten US-amerikanischen Sexualwissenschaftlern des 20. Jahrhunderts gezählt.
Internationale Bekanntheit erlangte Money durch ein Experiment an einem 2-jährigen Zwillingsjungen (der sog. Fall „John/Joan“). Money riet 1967 den Eltern des knapp zwei Jahre alten Jungen Bruce Reimer, ihren Sohn einer feminisierenden Operation zu unterziehen, nachdem dessen Penis bei einer medizinisch indizierten Zirkumzision versehentlich irreparabel verletzt worden war. Die entsprechende Operation wurde vorgenommen als Bruce 22 Monate alt war. Ab dem 12. Lebensjahr wurde er mit weiblichen Hormonen behandelt. Man sah dies als Gelegenheit, im Rahmen einer Zwillingsstudie zu beobachten, ob das Kind sich anders entwickeln würde als sein Zwillingsbruder. „Brenda“, wie Bruce nun genannt wurde, nahm die zugewiesene Geschlechterrolle jedoch nicht an. Ab elf Jahren quälten ihn Selbstmordgedanken. Mit 13 Jahren erfuhr er, dass er als Junge auf die Welt gekommen war und ließ die „Geschlechtsumwandlung“ rückgängig machen. Fortan nannte er sich David. Im Frühjahr 2004 beging David Reimer Suizid. Zwei Jahre zuvor war sein Zwillingsbruder durch eine Medikamentenüberdosis gestorben. John Money benutzte das Experiment als wissenschaftlichen Beweis für die gefahrlose operative Geschlechtsumwandlung. Zahlreiche Aktivisten und Theoretiker im Bereich Gender und Feminismus taten es ihm gleich.
Money befürwortete die Sexualisierung von Kindern. Er sprach sich für sexuelle Schulung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus, die seiner Ansicht nach auch spielerische Proben und Pornografie miteinschließen sollte. Seiner Meinung nach sollten alle sexuellen Beziehungen, insbesondere auch solche zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, als besondere Fälle von „Paarbindungen“ aufgefasst werden. Er verurteilte „Tabus“ ebenso wie eine Viktimologie, die einen der Beteiligten allein zum Täter macht und den anderen allein als Opfer herausstellt. Seine Kritiker sehen darin eine Tendenz, Pädophilie zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Sexuelle Perversionen bis hin zu Lustmord ordnete er als „Paraphilien“, als „abweichende Vorlieben“, ein.
Judith Butler (1954-) ist eine der prägendsten Gender-Theoretikerinnen unserer Zeit. Ihr 1990 erschienenes Buch „Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity“ (Deutscher Buchtitel: „Das Unbehagen der Geschlechter“) wird als Grundlagenwerk der Gender-Theorie verstanden. Butlers Leitfrage ist: „Wie kann man am besten die Geschlechter-Kategorie stören, die die Geschlechter-Hierarchie und die Zwangsheterosexualität stützen? (…) Die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist (…), den Phallogozentrismus und die Zwangsheterosexualität (…) zu dezentrieren (…) und die starren, hierarchischen sexuellen Codes wirksam zu de-regulieren.“ Seither prägt Butler mit der „subversiven Gender-Theorie“ die Gender-Mainstreaming Agenda. Butler geht davon aus, dass es das biologische Geschlecht gar nicht gibt, sondern dieses eine Fiktion der Sprache sei. Das biologische Geschlecht werde durch Sprache erzeugt. Es gebe laut Butler kein männliches oder weibliches Wesen, sondern nur eine bestimmte „performance“, ein Verhalten, das sich jederzeit ändern könne. Im „Inzesttabu“ (kulturelle Norm, die Sexualität zwischen Mitgliedern der Kernfamilie ausschließt) sieht Butler die Ursache der „Zwangsidentifizierung“ mit männlichem oder weiblichem Geschlecht und dem Tabu gegen die Homosexualität. Ziel Butlers ist die Auflösung der Geschlechtsidentität. Dann emanzipiere sich das Individuum aus der „Diktatur der Natur“. Nur solange es Frauen gebe, könnten Frauen unterdrückt werden, nur solange es „heterosexuelle Zwangsnormativität“ gebe, könnten „andere Formen des Begehrens“ ausgegrenzt werden. Obgleich sie für die vollständige Auflösung der Geschlechterkategorien eintritt, erklärt sie, dass es „strategisch oder übergangsweise sinnvoll ist, sich auf die Frauen zu berufen, um in ihrem Interesse repräsentative Forderungen zu erheben“.
Butler gilt außerdem als eine der wichtigsten „queer“-Theoretikerinnen. Das Wort „queer“ solle die Gefangenschaft in Begriffen aufheben, die selbst in der Negation der Heterosexualität diese immer noch voraussetze. Als „queer“ könne alles bezeichnet werden, was nicht straight (im Sinne von heterosexuell) ist. Die Polarität von Hetero- und Homosexualität solle zugunsten einer vollständigen Auflösung der geschlechtlichen Identität weichen, weil erst dann die „Hegemonie der Zwangsheterosexualität“ gänzlich überwunden werde und der Mensch die völlige Freiheit der Selbsterfindung erlange.
Quelle: „Die globale sexuelle Revolution“, Kuby Gabriele (2012), 1. Aufl., Kißleg
Frauen begannen im 19. Jahrhundert gegen die Vorherrschaft des Mannes zu rebellieren. Die Produktionsverhältnisse hatten sich verändert, wodurch sich auch die Rolle der Frau innerhalb der Familie veränderte. Bis ins 20. Jahrhundert hinein durften Frauen beispielsweise nicht auf höhere Schulen oder Universitäten gehen, nicht wählen, kein Bankkonto eröffnen, nur selten einen Beruf ausüben und keine öffentlichen Ämter oder Führungspositionen bekleiden. Zunächst forderten Frauen aus der gebildeten Mittelschicht gleiche Rechte wie die Männer. Sie kämpften insbesondere für politische Rechte, Bildungsrechte und bessere soziale Verhältnisse. Organisiert in christlichen Frauenvereinen setzten sie sich für den Schutz von Müttern und Familien ein. Ihre Forderungen sind in der westlichen Welt heute weitgehend erfüllt.
Parallel dazu entwickelte sich der kommunistische Widerstand gegen den Frühkapitalismus, als deren Vertreter Karl Marx (1818-1883) und Friedrich Engels (1820-1895) bekannt sind. Diese griffen das Gleichberechtigungsthema auf und deuteten es in eine Klassenfrage um. Engels bezeichnete die Unterdrückung des weiblichen Geschlechts durch das männliche im Rahmen der Einzelehe als erste Klassenunterdrückung. Er forderte deshalb die Abschaffung der Familie, die gleichartige Eingliederung von Mann und Frau in den Arbeitsprozess sowie die öffentliche Kindererziehung.
Eine wesentliche Zäsur in der Entwicklung des Feminismus stellte die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir (1908–1986) dar. Von ihr stammt die folgenschwere Aussage: „Man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht.“ Ihren Kampf um die „sexuelle Selbstbestimmung“ der Frau legte sie in ihrem Werk „Das andere Geschlecht (1949)“ dar. Sie propagierte die Legalisierung von Verhütung und Abtreibung als Mittel zur Emanzipation der Frau. Simone de Beauvoir und gleichgesinnte Feministinnen wollten mehr Gleichberechtigung für die Frauen erreichen und stellten sich dabei gegen die Ehe, die Familie sowie das Kind und traten für die vollständige Deregulierung der Sexualität ein.
Auf männlicher Seite war Magnus Hirschfeld (1868-1935) einer der ersten Aktivisten, der für die Legitimierung der Homosexualität eintrat. Er gilt als „Pionier der Sexualwissenschaft“ und entwickelte die Theorie, dass die binäre Geschlechterordnung zugunsten einer radikalen Individualisierung aufgelöst werden müsse. Seine politische Agenda veröffentlichte er als wissenschaftliche Theorie und behauptete, dass jeder Mann und jede Frau eine einzigartige Mischung männlicher und weiblicher Anteile sei. Hirschfeld kämpfte einerseits für die Akzeptanz der Homosexualität, andererseits ging er davon aus, dass Homosexualität eine „angeborene Missbildung“ sei. Er bezeichnete homosexuelle Männer und Frauen als „Unglückliche, Entrechtete, die den Fluch eines geheimnisvollen Rätsels der Natur durch ihr einsames Leben schleppen“. Und weiter: „Jedem Arzt, der neue Behandlungsmöglichkeiten aufweist, müssen wir dankbar sein, da vielen Homosexuellen der gewiss berechtigte Wunsch innewohnt, heterosexuell zu sein.“ Hirschfeld gründete 1908 die „Zeitschrift für Sexualwissenschaft“ und 1919 das „Institut für Sexualwissenschaft“, das in Europas Hauptstädten Kongresse für „Sexualreform auf wissenschaftlicher Grundlage“ organisierte. 1923 gründete er das „Institut für Freikörperkultur“ und 1928 die „Weltliga für Sexualreform“, womit er die Grundlage für die internationale Vernetzung von Homosexuellen-Bewegungen legte. Außerdem erkannte er das Potential der Medien und initiierte die Produktion des Films „Anders als die Anderen“, bei dem er selbst mitwirkte. Auf seinen Grabstein in Nizza ist sein Leitmotto graviert: „Per scientiam ad iustitia“ („Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit“). Das Vermächtnis von Hirschfeld wirkt weiter, etwa indem die 1990 gegründete deutsche „Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung“ die Magnus-Hirschfeld-Medaille für besondere Verdienste um Sexualwissenschaft und Sexualreform verleiht oder in der 2011 mit 10 Millionen errichteten deutschen „Bundesstiftung Magnus Hirschfeld“.
Um „Zwangsehe“ und „Zwangsfamilie als Erziehungsapparat“ zu eliminieren und im Rahmen der „Orgasmustheorie“ gesund zu bleiben, setzte der Schüler Sigmund Freuds (1856-1939), Wilhelm Reich (1897-1957), auf die Sexualisierung der Massen und der Kinder. Dadurch wollte er nach eigenen Worten „die infantilen Bindungen an die Eltern und damit die sexuelle Repression“ auflösen. Reich ging davon aus, dass die Sexualisierung des Menschen seine Beziehungen zu Autoritäten zerstöre. Dies wiederum sei ein notwendiger Schritt, um „frei“ zu werden. Reich behauptete, dass der Mensch glücklich werde, wenn er seine sexuellen Bedürfnisse ohne jede Einschränkung befriedigen könne. Neben Massenveranstaltungen, die er für Erwachsene organisierte, versuchte er Kinder und Jugendliche von der „sexualverneinenden und -verleugnenden Erziehung“ zu befreien und sie durch Sexualisierung aus dem Familienverband zu lösen. Wissenschaftlich untermauerte er seine Thesen mit der Psychoanalyse. Weil er einen Apparat zur Produktion von „Lebensenergie“ erfand und verkaufte, wurde er wegen Betrug zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er starb 1957 im Zuchthaus Lewisburg. Seine Theorien wurden später teilweise von Adorno, Horkheimer und Marcuse im Rahmen der „Frankfurter Schule“ übernommen und durch die 68er-Revolution weitergegeben.
Hatte Hirschfeld Anfang des 20. Jahrhunderts den theoretischen Grundstein für die Gender Theorie gelegt, setzte der Psychiater John Money (1921-2006) diese in die medizinische Praxis um. In den 1960er Jahren eröffnete er die erste Klinik für operative Geschlechtsumwandlung, die Gender Identity Clinic, in Baltimore/USA. Money führte die Begriffe „Geschlechtsidentität“ („gender identity“) und „Geschlechterrolle“ („gender role“) ein. Bis heute wird er zu den einflussreichsten US-amerikanischen Sexualwissenschaftlern des 20. Jahrhunderts gezählt.
Internationale Bekanntheit erlangte Money durch ein Experiment an einem 2-jährigen Zwillingsjungen (der sog. Fall „John/Joan“). Money riet 1967 den Eltern des knapp zwei Jahre alten Jungen Bruce Reimer, ihren Sohn einer feminisierenden Operation zu unterziehen, nachdem dessen Penis bei einer medizinisch indizierten Zirkumzision versehentlich irreparabel verletzt worden war. Die entsprechende Operation wurde vorgenommen als Bruce 22 Monate alt war. Ab dem 12. Lebensjahr wurde er mit weiblichen Hormonen behandelt. Man sah dies als Gelegenheit, im Rahmen einer Zwillingsstudie zu beobachten, ob das Kind sich anders entwickeln würde als sein Zwillingsbruder. „Brenda“, wie Bruce nun genannt wurde, nahm die zugewiesene Geschlechterrolle jedoch nicht an. Ab elf Jahren quälten ihn Selbstmordgedanken. Mit 13 Jahren erfuhr er, dass er als Junge auf die Welt gekommen war und ließ die „Geschlechtsumwandlung“ rückgängig machen. Fortan nannte er sich David. Im Frühjahr 2004 beging David Reimer Suizid. Zwei Jahre zuvor war sein Zwillingsbruder durch eine Medikamentenüberdosis gestorben. John Money benutzte das Experiment als wissenschaftlichen Beweis für die gefahrlose operative Geschlechtsumwandlung. Zahlreiche Aktivisten und Theoretiker im Bereich Gender und Feminismus taten es ihm gleich.
Money befürwortete die Sexualisierung von Kindern. Er sprach sich für sexuelle Schulung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus, die seiner Ansicht nach auch spielerische Proben und Pornografie miteinschließen sollte. Seiner Meinung nach sollten alle sexuellen Beziehungen, insbesondere auch solche zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, als besondere Fälle von „Paarbindungen“ aufgefasst werden. Er verurteilte „Tabus“ ebenso wie eine Viktimologie, die einen der Beteiligten allein zum Täter macht, den anderen allein als Opfer herausstellt. Seine Kritiker sehen darin eine Tendenz, Pädophilie zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Sexuelle Perversionen bis hin zu Lustmord ordnete er als „Paraphilien“, als „abweichende Vorlieben“, ein.
Judith Butler (1954-) ist eine der prägendsten Gender-Theoretikerinnen unserer Zeit. Ihr 1990 erschienenes Buch „Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity“ (Deutscher Buchtitel: „Das Unbehagen der Geschlechter“) wird als Grundlagenwerk der Gender-Theorie verstanden. Butlers Leitfrage ist: „Wie kann man am besten die Geschlechter-Kategorie stören, die die Geschlechter-Hierarchie und die Zwangsheterosexualität stützen? (…) Die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist (…), den Phallogozentrismus und die Zwangsheterosexualität (…) zu dezentrieren (…) und die starren, hierarchischen sexuellen Codes wirksam zu de-regulieren.“ Seither prägt Butler mit der „subversiven Gender-Theorie“ die Gender-Mainstreaming Agenda. Butler geht davon aus, dass es das biologische Geschlecht gar nicht gibt, sondern dieses eine Fiktion der Sprache sei. Das biologische Geschlecht werde durch Sprache erzeugt. Es gebe laut Butler kein männliches oder weibliches Wesen, sondern nur eine bestimmte „performance“, ein Verhalten, das sich jederzeit ändern könne. Im „Inzesttabu“ (kulturelle Norm, die Sexualität zwischen Mitgliedern der Kernfamilie ausschließt) sieht Butler die Ursache der „Zwangsidentifizierung“ mit männlichem oder weiblichem Geschlecht und dem Tabu gegen die Homosexualität. Ziel Butlers ist die Auflösung der Geschlechtsidentität. Dann emanzipiere sich das Individuum aus der „Diktatur der Natur“. Nur solange es Frauen gebe, könnten Frauen unterdrückt werden, nur solange es „heterosexuelle Zwangsnormativität“ gebe, könnten „andere Formen des Begehrens“ ausgegrenzt werden. Obgleich sie für die vollständige Auflösung der Geschlechterkategorien eintritt, erklärt sie, dass es „strategisch oder übergangsweise sinnvoll ist, sich auf die Frauen zu berufen, um in ihrem Interesse repräsentative Forderungen zu erheben“.
Butler gilt außerdem als eine der wichtigsten „queer“-Theoretikerinnen. Das Wort „queer“ solle die Gefangenschaft in Begriffen aufheben, die selbst in der Negation der Heterosexualität diese immer noch voraussetze. Als „queer“ könne alles bezeichnet werden, was nicht straight (im Sinne von heterosexuell) ist. Die Polarität von Hetero- und Homosexualität solle zugunsten einer vollständigen Auflösung der geschlechtlichen Identität weichen, weil erst dann die „Hegemonie der Zwangsheterosexualität“ gänzlich überwunden werde und der Mensch die völlige Freiheit der Selbsterfindung erlange.