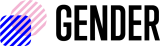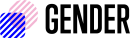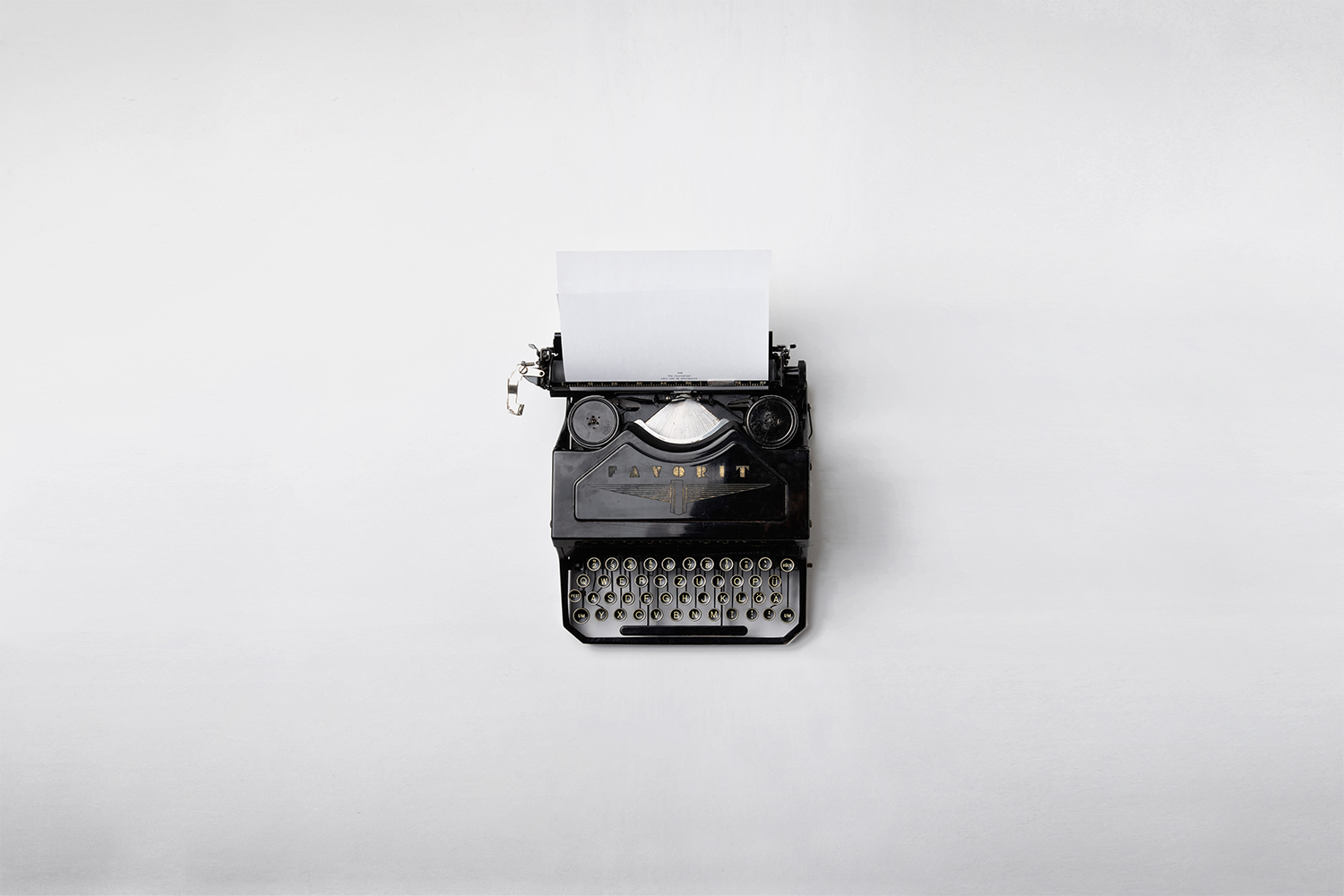Die feministische Linguistik ist eine soziolinguistische Teildisziplin. Sie untersucht und analysiert Sprache auf die in ihrer Grammatik transportierten (sexistischen und Frauen marginalisierenden) Strukturen und Wertesystemen. Aus ihrer Kritik leitet sich die heute kontrovers diskutierte gendersensible Sprache (Binnen-I, Sternchen-Schreibweise, etc.) ab. Aus der feministischen Linguistik entwickelte sich die linguistische Genderforschung. Die Genderlinguistik wurde allerdings weder in Deutschland noch in Österreich institutionalisiert. Das bedeutet, dass es – im Gegensatz zu den USA – bisher keinen Lehrstuhl mit feministischer,- bzw. genderlinguistischer Ausrichtung gibt.
Bis heute ist die feministische Linguistik bzw. Genderlinguistik umstritten und ein ideologisch umkämpftes Feld.[1] Die feministische Linguistik ist keine rein objektive wissenschaftliche Disziplin, denn ihre Vertreterinnen verfolgen explizit sprachpolitische Ansprüche. Eine der Begründerinnen der deutschen feministischen Linguistik, Luise F. Pusch, schreibt im Jahr 1990: „Als feministische Wissenschaft ist die feministische Systemlinguistik ,parteilich´, d.h., sie bewertet und kritisiert ihre Befunde, begnügt sich nicht mit der Beschreibung, sondern zielt auf Änderung des Systems in Richtung auf eine gründliche Entpatrifizierung und partielle Feminisierung, damit aus Männersprachen humane Sprachen werden.“[2]
[1] Kotthoff, Helga und Nübling, Damaris: Genderlinguistik. Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2019, S.17
[2] Ebd, S.13
1. Das generische Maskulinum
Feministische Linguistinnen lehnen die Verwendung des generischen Maskulinums (Tourist, Zuhörer, Leser oder Indefinitpronomen wie man, keiner, niemand) ab. Im Deutschen fällt das generische Maskulinum, bei dem Frauen auch angesprochen sind, mit dem spezifischen Maskulinum, bei dem ausschließlich Männer gemeint sind, zusammen. Die feministische Linguistik kritisiert, dass durch das generische Maskulinum das biologische Geschlecht (Sexus) unsichtbar gemacht wird. Während Männer sich sicher sein könnten, dass sie bei der Verwendung von maskulinen Personenbezeichnungen in jedem Fall gemeint seien, sei es für Frauen unklar, ob sie mitgemeint sind oder nicht.
2. Movierung
In der Sprachwissenschaft versteht man unter Movierung die Anpassung eines Wortes an das jeweilige Genus (z.B. der Lehrer – die Lehrerin). Feministische Linguistinnen plädierten für die Abschaffung des -in Suffixes, da sie in Movierungen eine Nachrangigkeit des Weiblichen wahrnehmen. Luise F. Putsch schlug daher 1984 vor, dass ein und demselben Substantiv drei Genera zukommen sollten: das Pilot (geschlechtsneutral) – die Pilot (w.) – der Pilot (m.). Dieser Vorschlag setzte sich aber nie durch.[1]
[1] Ebd, S.76.
3. Diminutive und geschlechtsstereotype Genuszuweisungen
Linguistische Feministinnen kritisierten z.B. die diminutive Anredeform „Fräulein“. Hier bestehe eine Asymmetrie, da es kein vergleichbares männliches Gegenstück gäbe. Kritisiert wurden aus diesem Grund auch die Frauenbezeichnungen im Neutrum (das Mädchen, das Weib, im Unterschied zu der Junge oder der Bub).
Die Geschichte der Gendersprache und ihre Entwicklung geht Hand in Hand mit der Geschichte des Feminismus sowie den Folgen der sexuellen Revolution von 1968. Die ersten linguistischen Studien „zum Zusammenhang von Patriarchat, Sprache und Diskurs“[1] entstanden Anfang der 1970er Jahre in den USA. Linguistinnen (Robin Lakoff oder Mary Richie Key) und Feministinnen (Kate Swift, Casesy Miller) untersuchten, wie Sprache Frauen marginalisiert. Die sogenannte „feministische Linguistik“ erreichte Mitte der 1970er Jahre auch Deutschland. Hier waren die Begründerinnen die Linguistinnen Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz. Sie griffen Fragestellungen aus den USA auf und übertrugen sie auf das Deutsche. 1980 erschien in der Fachzeitschrift „Linguistische Berichte“ der Beitrag „Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs“ von vier Sprachwissenschaftlerinnen (u.a. Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz). Die aufgestellten Richtlinien gelten als Grundstein für alle weiteren Bemühungen, gendersensible Sprache zu verbreiten. Dort stellen die Sprachwissenschaftlerinnen angeblich sexistischer Sprache „geschlechtergerechte Alternativen“ gegenüber. Als Zielgruppe für ihre Vorschläge nannten die Autorinnen Institutionen, die Sprache unterrichten, wie Schulen und Universitäten, und solche, die Sprache verbreiten, z.B. Medien. Als Reaktionen auf die „Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs“ erschien im März 1983 ein Artikel in der Wochenzeitung „Die Zeit“ mit dem Titel „Efrauzipation“, der Kritik übte. „Den Geschlechterkampf auf dem Gebiet der Sprache weiterführen zu wollen, das bringt nichts und führt zu nichts.“, heißt es dort.[2]
1. Dokumente, die einen „nicht-sexistischen Sprachgebrauch“ vorschlagen
Ab Anfang der 90er Jahre geben wichtige nationale und internationale Organisationen, aber auch immer mehr Regierungen, sogenannte „Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch“ heraus.
1.1 Deutsche UNESCO-Kommission
1993 brachte die Deutsche UNESCO-Kommission das Dokument „Eine Sprache für beide Geschlechter“ heraus. Die Verfasserinnen Marlis Hellinger und Christine Bierlach – Hellinger war Mitverfasserin der ersten „Richtlinien“ von 1980 – schlagen zum Beispiel vor, in Texten und Dokumenten geschlechtsneutrale Begriffe wie die Person, die Fachkraft oder der Mensch zu verwenden oder die aus dem Partizip abgeleiteten Personenbezeichnungen (die Reisenden, die Studierenden). Spricht man von Menschengruppen, soll auch die feminine Bezeichnung verwendet werden (z.B. Kolleginnen und Kollegen). Die Verfasserinnen beziehen sich dabei auf die 24. Generalkonferenz der UNESCO von 1987, auf der die Organisation Forderungen nach einem nicht-sexistischen Sprachgebrauch „nachdrücklich“ erhob. In dem Dokument wird auch das Binnen-I diskutiert. Die Autorinnen bezeichnen das Binnen-I als „ökonomische und originelle Lösung“, bilden jedoch gleichzeitig die Kontroverse, da die in verschiedenen Beschlüssen deutscher Landesregierungen zu der Verwendung zur „Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltungssprache“ darüber herrscht. [1]
[1] UNESCO-Dokument „Eine Sprache für beide Geschlechter“
1.2 Österreich
1987 erstellten österreichische Sprachwissenschaftlerinnen das Dokument „Sprachliche Gleichbehandlung von Mann und Frau: Linguistische Empfehlungen zur Gleichbehandlung von Mann und Frau im öffentlichen Bereich“. Die Broschüre wurde vom österreichischen Bundesministerium für Arbeit und Soziales herausgegeben. Der zuständige Bundesminister war Alfred Dallinger (SPÖ).
1.3 Deutschland
1984 erklärt Hessens Landesregierung als erste deutsche Landesregierung in dem „Runderlass Gleichbehandlung von Frauen und Männern“, dass generische Maskulinformen nicht als geschlechterübergreifende Oberbegriffe anzusehen sind und stattdessen neutrale Bezeichnungen oder die weibliche und männliche Form aufgeführt werden sollen. Ministerpräsident von Hessen war damals Holger Börner (SPD).
1.4 Europäische Union
2008 beschließt das Europäische Parlament mehrsprachige Leitlinien zum geschlechterneutralen Sprachgebrauch. „Als geschlechterneutraler Sprachgebrauch wird eine sexismusfreie, inklusivere und geschlechtergerechte Ausdrucksweise bezeichnet. Es geht darum, eine Wortwahl zu vermeiden, durch die impliziert wird, ein biologisches oder soziales Geschlecht stelle die Norm da, […]“, heißt es in dem Bericht.[1]
2. Aus der feministischen Sprachkritik wird queere Sprachkritik
Eine Zäsur in der gendergerechten Sprache in Österreich stellt das Urteil des Verfassungsgerichtshof vom 15. Juni 2018 dar. Seit 2019 ist es möglich, die Geschlechtszugehörigkeit im Personenstandsregister auf „intersexuell“ (= sog. „3. Geschlecht“) zu ändern. Für die Eintragung der Geschlechtskategorie stehen die Begriffe „divers“, „inter“ oder „offen“ zur Verfügung. Weiters ist auch eine Streichung des Geschlechtseintrags möglich.[1] Seit 2018 ist dies auch in Deutschland möglich.
Nach den Verfassungsurteilen zur dritten Geschlechtsoption „intersexuell“ haben viele Gleichstellungsbeauftragte in Absprache mit Leitungsgremien und Fachabteilungen ihre internen Empfehlungen und Leitlinien angepasst, um in der offiziellen Kommunikation auch weitere Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen („Inter- und Transpersonen“). Seit Anerkennung des sog. “3. Geschlechts” reicht es demnach nicht mehr, Frauen in der Sprache sichtbarer zu machen (z.B. durch das Binnen-I oder den Schrägstrich). Zur Sichtbarmachung nichtbinärer Personen werden Genderzeichen eingeführt (Gendergap, Genderstern, Doppelpunkt).
Zweigeschlechtliche („binäre“) Lösungen
1. Sichtbarmachung der Geschlechter (m/w)
| Schrägstrich | Lehrer/Lehrerinnen, Lehrer/innen |
| Binnen-I | LehrerInnen, ein/e LehrerIn |
| Klammern | Lehrer(innen) |
| Paarformen | Lehrer und Lehrerinnen |
2. Neutralisierung von Geschlecht
| Sexusindifferente Personenbezeichnungen | Lehrpersonen |
| Substantivierte Partizipien oder Adjektive | Lehrende, Studierende |
| Sachbezeichnungen | Lehrkraft, Putzkraft |
| Alternativer Vorschlag X-Endung | einx gutx Lehrx |
3. Mehrgeschlechtliche („nicht-binäre“) Lösungen
| Gender Gap („Unterstrich“) | Lehrer_innen, ein_e Lehrer_in |
| Genderstern („Asterisk“) | Lehrer*innen, ein*e Lehrer*in |
| Doppelpunkt | Lehrer:innen, ein:e Lehrer:in |
Der Gender Gap hat seinen Ursprung in der Queer-Theorie, einer Kulturtheorie aus den USA, die maßgeblich von Judith Butler („Das Unbehagen der Geschlechter“) geprägt wurde. Der Gender Gap geht auf den Philosophen Steffen Kitty Herrmann zurück, der in einem Artikel aus dem Jahr 2003 eine nicht-diskriminierende Darstellungsform für alle Geschlechter schaffen wollte.[1] Der Platz zwischen der männlichen Endung eines Wortes und dem weiblichen Suffix „-in“ oder „-innen“ soll verdeutlichen, dass es mehr als zwei Geschlechtsidentitäten gibt.
Das Gendersternchen ist eine weitere Variante des Gender Gap. Sein Aufstieg begann 2015 – so schreibt der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch in einem Beitrag der Wochenzeitung „Die Zeit“. Damals beschlossen die Grünen in Deutschland auf ihrem Parteitag, dass das Binnen-I nicht genug sei und führten das Gendersternchen für parteiliche Schriftstücke ein. Bald darauf begannen verschiedene deutsche Behörden, das Sternchen zu verwenden.[2]
[1] Herrmann, Steffen Kitty: Performing the gap: Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung. In: Arranca!, Berlin, Band 28 (2003).
[2] https://www.zeit.de/kultur/2019-01/gender-sprache-geschlechtergerechtigkeit-hannover-leitfaden-gleichstellung/seite-2
Um die Kontroverse über den Gebrauch des generischen Maskulinums zu verstehen, muss ein Wort verloren werden über das sogenannte Genus-Sexus-Prinzip.
Die Linguistik unterscheidet zwischen Sexus und Genus. Sexus bezeichnet hier das natürliche (biologische) Geschlecht eines Menschen (weiblich und männlich). Der Genus ist eine sprachinterne, grammatikalische Kategorie und meint die drei Genera Maskulinum, Femininum und Neutrum (der, die, das). Nach welchen Regeln erfolgt in der deutschen Sprache nun die Zuweisung des Genus an Substantive? Prinzipiell trägt der Genus nichts zur Bedeutung eines Substantivs bei. Die Lampe hat nichts Weibliches, der Tisch nichts Männliches und das Tuch nichts Sächliches an sich. Andererseits kann der Genus oft aus der Bedeutung des Substantivs abgeleitet werden. Das bedeutet, dass Substantive, die Frauen bezeichnen, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit feminin sind, und solche, die Männer bezeichnen, wahrscheinlich maskulin sind (z.B. der Vater, die Mutter, der Hengst, die Stute) Linguistisch ausgedrückt: Die Genuszuweisung erfolgt hier semantisch. Es gibt also Bezüge zwischen dem grammatischen Genus und dem biologischen Geschlecht.[1] Dass im menschlichen Bewusstsein ein enger Zusammenhang zwischen Genus und Sexus besteht, zeigt sich beispielsweise daran, dass Tieren und auch Gegenständen aufgrund ihres grammatischen Geschlechts ein biologisches zugeordnet wird (z.B. wird die „Biene Maia“ in der gleichnamigen Serie als Mädchen dargestellt). Eine empirische Studie zum Verhältnis von Genus und Sexus am Beispiel zu Tierbezeichnungen in Kinderbüchern ergab, dass es dort zu einer circa 90%-igen Übereinstimmung zwischen Genus und dem zugewiesenen Geschlecht gibt.[2]
[1] Vgl. Kotthoff, Nübling, S.69
[2] Nübling, Damaris: Genus und Geschlecht. Zum Zusammenhang von grammatischer, biologischer und sozialer Kategorisierung. In: Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 2020, Nr.1. In: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz: Franz Steiner Verlag, 2020, S.12.
Wie eingangs schon erwähnt, ist die Genderlinguistik ein umstrittenes und ideologisch umkämpftes Feld. Die feministische Linguistik ist keine rein objektive wissenschaftliche Disziplin, denn ihre Vertreterinnen verfolgen explizit sprachpolitische Ansprüche (siehe unter “Was ist ‘feministische Linguistik’ bzw ‘Genderlinguistik’?”). „Was für das Deutsche fehlt, ist eine möglichst wertungsfreie Genderlinguistik […]“[1], stellen die Autorinnen des Studienbuches „Genderlinguist: Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht“ fest. Die deutschen Gender Studies seien sehr von der Judith Butler-Rezeption geprägt.[2] Die Philosophin Judith Butler geht davon aus, das Geschlecht, auch das biologische, ein Konstrukt sei.
[1] Kotthoff, Nübling, S.13
[2] Ebd., S.47
1. Rat für deutsche Rechtschreibung
Der „Rat für deutsche Rechtschreibung“, der sich selbst als „die maßgebende Instanz für die deutsche Rechtschreibung“ bezeichnet, empfiehlt die „Aufnahme von Gender-Stern, Unterstrich, Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung“ nicht. Ihr hauptsächlicher Kritikpunkt an diesen Formen der gendersensiblen Schreibung ist, dass sie die Verständlichkeit und Vorlesbarkeit der Wörter beeinträchtigen, besonders für Erwachsene mit geringer Literalität sowie Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Gendergerechte Sprache sei eine „gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden kann“.[1]
[1] Vgl. Pressemitteilung des Rates für deutsche Rechtschreibung vom 26.03.2021
2. Gesellschaft für deutsche Sprache
Auch die „Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.“ steht dem Gendersternchen, Gendergap und Doppelpunkt kritisch gegenüber. Eine „institutionell verordnete Umstrukturierung und Ergänzung großer Teile der deutschen Sprache steht einer natürlichen Sprachentwicklung […] konträr entgegen“, schreiben sie auf ihrer Homepage.[1] Die Gesellschaft für deutsche Sprache argumentiert, dass diese Formen (genauso wie das Binnen-I) kein Bestandteil der aktuellen Rechtschreibung seien. Einige Schreibungen, bei denen die männliche und weibliche Form angegeben werden, begrüßen sie (z.B. die Schrägstrichlösung oder die Klammerlösung). Die Gesellschaft für deutsche Sprache teile allerdings nicht die Ansicht, das grammatische Geschlecht habe nichts mit dem natürlichen Geschlecht zu tun.
Die feministische Linguistik ist eine soziolinguistische Teildisziplin. Sie untersucht und analysiert Sprache auf die in ihrer Grammatik transportierten (sexistischen und Frauen marginalisierenden) Strukturen und Wertesystemen. Aus ihrer Kritik leitet sich die heute kontrovers diskutierte gendersensible Sprache (Binnen-I, Sternchen-Schreibweise, etc.) ab. Aus der feministischen Linguistik entwickelte sich die linguistische Genderforschung. Die Genderlinguistik wurde allerdings weder in Deutschland noch in Österreich institutionalisiert. Das bedeutet, dass es – im Gegensatz zu den USA – bisher keinen Lehrstuhl mit feministischer,- bzw. genderlinguistischer Ausrichtung gibt.
Bis heute ist die feministische Linguistik bzw. Genderlinguistik umstritten und ein ideologisch umkämpftes Feld.[1] Die feministische Linguistik ist keine rein objektive wissenschaftliche Disziplin, denn ihre Vertreterinnen verfolgen explizit sprachpolitische Ansprüche. Eine der Begründerinnen der deutschen feministischen Linguistik, Luise F. Pusch, schreibt im Jahr 1990: „Als feministische Wissenschaft ist die feministische Systemlinguistik ,parteilich´, d.h., sie bewertet und kritisiert ihre Befunde, begnügt sich nicht mit der Beschreibung, sondern zielt auf Änderung des Systems in Richtung auf eine gründliche Entpatrifizierung und partielle Feminisierung, damit aus Männersprachen humane Sprachen werden.“[2]
[1] Kotthoff, Helga und Nübling, Damaris: Genderlinguistik. Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2019, S.17
[2] Ebd, S.13
1. Das generische Maskulinum
Feministische Linguistinnen lehnen die Verwendung des generischen Maskulinums (Tourist, Zuhörer, Leser oder Indefinitpronomen wie man, keiner, niemand) ab. Im Deutschen fällt das generische Maskulinum, bei dem Frauen auch angesprochen sind, mit dem spezifischen Maskulinum, bei dem ausschließlich Männer gemeint sind, zusammen. Die feministische Linguistik kritisiert, dass durch das generische Maskulinum das biologische Geschlecht (Sexus) unsichtbar gemacht wird. Während Männer sich sicher sein könnten, dass sie bei der Verwendung von maskulinen Personenbezeichnungen in jedem Fall gemeint seien, sei es für Frauen unklar, ob sie mitgemeint sind oder nicht.
2. Movierung
In der Sprachwissenschaft versteht man unter Movierung die Anpassung eines Wortes an das jeweilige Genus (z.B. der Lehrer – die Lehrerin). Feministische Linguistinnen plädierten für die Abschaffung des -in Suffixes, da sie in Movierungen eine Nachrangigkeit des Weiblichen wahrnehmen. Luise F. Putsch schlug daher 1984 vor, dass ein und demselben Substantiv drei Genera zukommen sollten: das Pilot (geschlechtsneutral) – die Pilot (w.) – der Pilot (m.). Dieser Vorschlag setzte sich aber nie durch.[1]
[1] Ebd, S.76.
3. Diminutive und geschlechtsstereotype Genuszuweisungen
Linguistische Feministinnen kritisierten z.B. die diminutive Anredeform „Fräulein“. Hier bestehe eine Asymmetrie, da es kein vergleichbares männliches Gegenstück gäbe. Kritisiert wurden aus diesem Grund auch die Frauenbezeichnungen im Neutrum (das Mädchen, das Weib, im Unterschied zu der Junge oder der Bub).
Die Geschichte der Gendersprache und ihre Entwicklung geht Hand in Hand mit der Geschichte des Feminismus sowie den Folgen der sexuellen Revolution von 1968. Die ersten linguistischen Studien „zum Zusammenhang von Patriarchat, Sprache und Diskurs“[1] entstanden Anfang der 1970er Jahre in den USA. Linguistinnen (Robin Lakoff oder Mary Richie Key) und Feministinnen (Kate Swift, Casesy Miller) untersuchten, wie Sprache Frauen marginalisiert. Die sogenannte „feministische Linguistik“ erreichte Mitte der 1970er Jahre auch Deutschland. Hier waren die Begründerinnen die Linguistinnen Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz. Sie griffen Fragestellungen aus den USA auf und übertrugen sie auf das Deutsche. 1980 erschien in der Fachzeitschrift „Linguistische Berichte“ der Beitrag „Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs“ von vier Sprachwissenschaftlerinnen (u.a. Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz). Die aufgestellten Richtlinien gelten als Grundstein für alle weiteren Bemühungen, gendersensible Sprache zu verbreiten. Dort stellen die Sprachwissenschaftlerinnen angeblich sexistischer Sprache „geschlechtergerechte Alternativen“ gegenüber. Als Zielgruppe für ihre Vorschläge nannten die Autorinnen Institutionen, die Sprache unterrichten, wie Schulen und Universitäten, und solche, die Sprache verbreiten, z.B. Medien. Als Reaktionen auf die „Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs“ erschien im März 1983 ein Artikel in der Wochenzeitung „Die Zeit“ mit dem Titel „Efrauzipation“, der Kritik übte. „Den Geschlechterkampf auf dem Gebiet der Sprache weiterführen zu wollen, das bringt nichts und führt zu nichts.“, heißt es dort.[2]
1. Dokumente, die einen „nicht-sexistischen Sprachgebrauch“ vorschlagen
Ab Anfang der 90er Jahre geben wichtige nationale und internationale Organisationen, aber auch immer mehr Regierungen, sogenannte „Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch“ heraus.
1.1 Deutsche UNESCO-Kommission
1993 brachte die Deutsche UNESCO-Kommission das Dokument „Eine Sprache für beide Geschlechter“ heraus. Die Verfasserinnen Marlis Hellinger und Christine Bierlach – Hellinger war Mitverfasserin der ersten „Richtlinien“ von 1980 – schlagen zum Beispiel vor, in Texten und Dokumenten geschlechtsneutrale Begriffe wie die Person, die Fachkraft oder der Mensch zu verwenden oder die aus dem Partizip abgeleiteten Personenbezeichnungen (die Reisenden, die Studierenden). Spricht man von Menschengruppen, soll auch die feminine Bezeichnung verwendet werden (z.B. Kolleginnen und Kollegen). Die Verfasserinnen beziehen sich dabei auf die 24. Generalkonferenz der UNESCO von 1987, auf der die Organisation Forderungen nach einem nicht-sexistischen Sprachgebrauch „nachdrücklich“ erhob. In dem Dokument wir auch das Binnen-I diskutiert. Die Autorinnen bezeichnen das Binnen-I als „ökonomische und originelle Lösung“, bilden jedoch gleichzeitig die Kontroverse da, die in verschiedenen Beschlüssen deutscher Landesregierungen zu der Verwendung zur „Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltungssprache“ darüber herrscht. [1]
[1] https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-05/eine_Sprache_fuer_beide_Geschlechter_1993_0.pdf
1.2 Österreich
1987 erstellten österreichische Sprachwissenschaftlerinnen das Dokument „Sprachliche Gleichbehandlung von Mann und Frau: Linguistische Empfehlungen zur Gleichbehandlung von Mann und Frau im öffentlichen Bereich“. Die Broschüre wurde vom österreichischen Bundesministerium für Arbeit und Soziales herausgegeben. Der zuständige Bundesminister war Alfred Dallinger (SPÖ).
1.3 Deutschland
1984 erklärt Hessens Landesregierung als erste deutsche Landesregierung in dem „Runderlass Gleichbehandlung von Frauen und Männern“, dass generische Maskulinformen nicht als geschlechterübergreifende Oberbegriffe anzusehen sind und stattdessen neutrale Bezeichnungen oder die weibliche und männliche Form aufgeführt werden sollen. Ministerpräsident von Hessen war damals Holger Börner (SPD).
1.4 Europäische Union
2008 beschließt das Europäische Parlament mehrsprachige Leitlinien zum geschlechterneutralen Sprachgebrauch. „Als geschlechterneutraler Sprachgebrauch wird eine sexismusfreie, inklusivere und geschlechtergerechte Ausdrucksweise bezeichnet. Es geht darum, eine Wortwahl zu vermeiden, durch die impliziert wird, ein biologisches oder soziales Geschlecht stelle die Norm da, […]“, heißt es in dem Bericht.[1]
[1] https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187092/GNL_Guidelines_DE-original.pdf
2. Aus der feministischen Sprachkritik wird queere Sprachkritik
Eine Zäsur in der gendergerechten Sprache in Österreich stellt das Urteil des Verfassungsgerichtshof vom 15. Juni 2018 dar. Seit 2019 ist es möglich, die Geschlechtszugehörigkeit im Personenstandsregister auf „intersexuell“ (= sog. „3. Geschlecht“) zu ändern. Für die Eintragung der Geschlechtskategorie stehen die Begriffe „divers“, „inter“ oder „offen“ zur Verfügung. Weiters ist auch eine Streichung des Geschlechtseintrags möglich.[1] Seit 2018 ist dies auch in Deutschland möglich.
Nach den Verfassungsurteilen zur dritten Geschlechtsoption „intersexuell“ haben viele Gleichstellungsbeauftragte in Absprache mit Leitungsgremien und Fachabteilungen ihre internen Empfehlungen und Leitlinien angepasst, um in der offiziellen Kommunikation auch weitere Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen („Inter- und Transpersonen“). Seit Anerkennung des sog. 3. Geschlechts reicht es demnach nicht mehr, Frauen in der Sprache sichtbarer zu machen (z.B. durch das Binnen-I oder den Schrägstrich). Zur Sichtbarmachung nichtbinärer Personen werden Genderzeichen eingeführt (Gendergap, Genderstern, Doppelpunkt).
[1] https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/%C3%84nderung-der-Geschlechtszugeh%C3%B6rigkeit.html
Zweigeschlechtliche („binäre“) Lösungen
1. Sichtbarmachung der Geschlechter (m/w)
| Schrägstrich | Lehrer/Lehrerinnen, Lehrer/innen |
| Binnen-I | LehrerInnen, ein/e LehrerIn |
| Klammern | Lehrer(innen) |
| Paarformen | Lehrer und Lehrerinnen |
2. Neutralisierung von Geschlecht
| Sexusindifferente Personenbezeichnungen | Lehrpersonen |
| Substantivierte Partizipien oder Adjektive | Lehrende, Studierende |
| Sachbezeichnungen | Lehrkraft, Putzkraft |
| Alternativer Vorschlag X-Endung | einx gutx Lehrx |
Mehrgeschlechtliche („nicht-binäre“) Lösungen
| Gender Gap („Unterstrich“) | Lehrer_innen, ein_e Lehrer_in |
| Genderstern („Asterisk“) | Lehrer*innen, ein*e Leher*in |
| Doppelpunkt | Lehrer:innen, ein:e Lehrer:in |
Der Gender Gap hat seinen Ursprung in der queer-Theorie, einer Kulturtheorie aus den USA, die maßgeblich von Judith Butler („Das Unbehagen der Geschlechter“) geprägt wurde. Der Gender Gap geht auf den Philosophen Steffen Kitty Herrmann zurück, der in einem Artikel aus dem Jahr 2003 eine nicht-diskriminierende Darstellungsform für alle Geschlechter schaffen wollte.[1] Der Platz zwischen der männlichen Endung eines Wortes und dem weiblichen Suffix „-in“ oder „-innen“ soll verdeutlichen, dass es mehr als zwei Geschlechtsidentitäten gibt.
Das Gendersternchen ist eine weitere Variante des Gender Gap. Sein Aufstieg begann 2015 – so schreibt der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch in einem Beitrag der Wochenzeitung „Die Zeit“. Damals beschlossen die Grünen in Deutschland auf ihrem Parteitag, dass das Binnen-I nicht genug sei und führten das Gendersternchen für parteiliche Schriftstücke ein. Bald darauf begannen verschiedene deutsche Behörden, das Sternchen zu verwenden.[2]
[1] Herrmann, Steffen Kitty: Performing the gap: Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung. In: Arranca!, Berlin, Band 28 (2003).
[2] https://www.zeit.de/kultur/2019-01/gender-sprache-geschlechtergerechtigkeit-hannover-leitfaden-gleichstellung/seite-2
Um die Kontroverse über den Gebrauch des generischen Maskulinums zu verstehen, muss ein Wort verloren werden über das sogenannte Genus-Sexus-Prinzip.
Die Linguistik unterscheidet zwischen Sexus und Genus. Sexus bezeichnet hier das natürliche (biologische) Geschlecht eines Menschen (weiblich und männlich). Der Genus ist eine sprachinterne, grammatikalische Kategorie und meint die drei Genera Maskulinum, Femininum und Neutrum (der, die, das). Nach welchen Regeln erfolgt in der deutschen Sprache nun die Zuweisung des Genus an Substantive? Prinzipiell trägt der Genus nichts zur Bedeutung eines Substantivs bei. Die Lampe hat nichts Weibliches, der Tisch nichts Männliches und das Tuch nichts Sächliches an sich. Andererseits kann der Genus oft aus der Bedeutung des Substantivs abgeleitet werden. Das bedeutet, dass Substantive, die Frauen bezeichnen, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit feminin sind, und solche, die Männer bezeichnen, wahrscheinlich maskulin sind (z.B. der Vater, die Mutter, der Hengst, die Stute) Linguistisch ausgedrückt: Die Genuszuweisung erfolgt hier semantisch. Es gibt also Bezüge zwischen dem grammatischen Genus und dem biologischen Geschlecht.[1] Dass im menschlichen Bewusstsein ein enger Zusammenhang zwischen Genus und Sexus besteht, zeigt sich zum Beispiel daran, dass Tieren und auch Gegenständen aufgrund ihres grammatischen Geschlechts ein biologisches zugeordnet wird (z.B. wird die „Biene Maia“ in der gleichnamigen Serie als Mädchen dargestellt). Eine empirische Studie zum Verhältnis von Genus und Sexus am Beispiel zu Tierbezeichnungen in Kinderbüchern ergab, dass es dort zu einer circa 90%-igen Übereinstimmung zwischen Genus und dem zugewiesenen Geschlecht gibt.[2]
[1] Vgl. Kotthoff, Nübling, S.69
[2] Nübling, Damaris: Genus und Geschlecht. Zum Zusammenhang von grammatischer, biologischer und sozialer Kategorisierung. In: Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 2020, Nr.1. In: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz: Franz Steiner Verlag, 2020, S.12.
Wie eingangs schon erwähnt, ist die Genderlinguistik ein umstrittenes und ideologisch umkämpftes Feld. Die feministische Linguistik ist keine rein objektive wissenschaftliche Disziplin, denn ihre Vertreterinnen verfolgen explizit sprachpolitische Ansprüche (siehe Seite 1). „Was für das Deutsche fehlt, ist eine möglichst wertungsfreie Genderlinguistik […]“[1], stellen die Autorinnen des Studienbuches „Genderlinguist: Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht“ fest. Die deutschen Gender Studies seien sehr von der Judith Butler-Rezeption geprägt.[2] Die Philosophin Judith Butler geht davon aus, das Geschlecht, auch das biologische, ein Konstrukt sei.
[1] Kotthoff, Nübling, S.13
[2] Ebd., S.47
1. Rat für deutsche Rechtschreibung
Der „Rat für deutsche Rechtschreibung“, der sich selbst als „die maßgebende Instanz für die deutsche Rechtschreibung“ bezeichnet, empfiehlt die „Aufnahme von Gender-Stern, Unterstrich, Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren in der Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung“ nicht. Ihr hauptsächlicher Kritikpunkt an diesen Formen der gendersensiblen Schreibung ist, dass sie die Verständlichkeit und Vorlesbarkeit der Wörter beeinträchtigen, besonders für Erwachsene mit geringer Literalität sowie Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Gendergerechte Sprache sei eine „gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden kann“.[1]
[1] Vgl. Pressemitteilung des Rates für deutsche Rechtschreibung vom 26.03.2021: https://www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_PM_2021-03-26_Geschlechtergerechte_Schreibung.pdf
2. Gesellschaft für deutsche Sprache
Auch die „Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.“ steht dem Gendersternchen, Gendergap und Doppelpunkt kritisch gegenüber. Eine „institutionell verordnete Umstrukturierung und Ergänzung großer Teile der deutschen Sprache steht einer natürlichen Sprachentwicklung […] konträr entgegen“, schreiben sie auf ihrer Homepage.[1] Die Gesellschaft für deutsche Sprache argumentiert, dass diese Formen (genauso wie das Binnen-I) kein Bestandteil der aktuellen Rechtschreibung seien. Einige Schreibungen, bei denen die männliche und weibliche Form angegeben werden, begrüßen sie (zum Beispiel die Schrägstrichlösung oder die Klammerlösung). Die Gesellschaft für deutsche Sprache teile allerdings nicht die Ansicht, das grammatische Geschlecht habe nichts mit dem natürlichen Geschlecht zu tun.
[1] https://gfds.de/standpunkt-der-gesellschaft-fuer-deutsche-sprache-gfds-zu-einer-geschlechtergerechten-sprache/
Auch die „Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.“ steht dem Gendersternchen, Gendergap und Doppelpunkt kritisch gegenüber. Eine „institutionell verordnete Umstrukturierung und Ergänzung großer Teile der deutschen Sprache steht einer natürlichen Sprachentwicklung […] konträr entgegen“, schreiben sie auf ihrer Homepage.[1] Die Gesellschaft für deutsche Sprache argumentiert, dass diese Formen (genauso wie das Binnen-I) kein Bestandteil der aktuellen Rechtschreibung seien. Einige Schreibungen, bei denen die männliche und weibliche Form angegeben werden, begrüßen sie (zum Beispiel die Schrägstrichlösung oder die Klammerlösung). Die Gesellschaft für deutsche Sprache teile allerdings nicht die Ansicht, das grammatische Geschlecht habe nichts mit dem natürlichen Geschlecht zu tun.
[1] https://gfds.de/standpunkt-der-gesellschaft-fuer-deutsche-sprache-gfds-zu-einer-geschlechtergerechten-sprache/
3. Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache
Der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache, Peter Schlobinski, sagt in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“, es gehe in der Gender-Debatte um gesellschaftliche Auseinandersetzungen und dahinterstehende Machtkämpfe. Hinter den Versuchen, die Sprache zu ändern, stehe ein sprachlicher Relativismus. Ändere man die Sprache, ändere sich das Denken und im nächsten Schritt gesellschaftliche Verhältnisse, erklärt der Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Hannover. Dies finde man auch bei Orwells Klassiker „1984“. Dort wolle man durch die neue Sprache die Gesellschaftsmitglieder lenken und formen, sagt Schlobinski.[1]
[1] https://www.tagesspiegel.de/politik/soll-da-wegen-einer-gesinnung-gegendert-werden-4252066.html
4. Verein Deutsche Sprache
Der gemeinnützige „Verein Deutsche Sprache e.V.“, der nach eigener Angabe 36 000 Mitglieder zählt, setzt sich unter anderem dafür ein, dass „Politik, Medien und Verwaltungen zum sprachlichen Standard zurückkehren […]“. Genderrichtlinien hätten nämlich keine rechtliche Grundlage.[1] Der Vorsitzende des Vereins, Walter Krämer, sagt in einem Interview mit Corrigenda, dass das Gendern „ein Frontalangriff auf die Funktionstätigkeit unserer Sprache“ sei. Das generische Maskulinum, argumentiert der emeritierte Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund, sei nicht markiert – im Gegensatz zum Femininum.[2]
[1] https://vds-ev.de/arbeitsgruppen/deutsch-in-der-oeffentlichkeit/ag-gendersprache/
[2] https://www.corrigenda.online/kultur/man-muss-etwas-fuer-die-sprache-tun-man-muss-fuer-sie-kaempfen
5. Umfragen zu Gendern
Fast zwei Drittel der Deutschen lehnen gendergerechte Sprache ab (65 Prozent der Bevölkerung). Das ergab eine Umfrage von „infratest dimap“ für „Welt am Sonntag“ im Jahr 2021. Bei Grünen-Wählern ist die höchste Befürwortung für gendergerechte Sprache (47 Prozent) zu finden, bei AfD-Anhängern die geringste (11 Prozent).[1]
Eine Studie des österreichischen Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Oktober 2022 ergab, dass 54 Prozent der Teilnehmer gegen bundesweite einheitliche Regeln für eine gendergerechte Schreibweise sind. 71 Prozent findet eine gendersensible Sprache in den Medien nicht gut. Die repräsentative Umfrage wurde von der „Kronen Zeitung“ in Auftrag gegeben.[2]
[1] https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/weiter-vorbehalte-gegen-gendergerechte-sprache/
[2] https://www.puls24.at/video/puls-24/herr-haselmayer-zahlen-bitte-wie-steht-oesterreich-zum-gendern/v-cntdhvv3cz9l