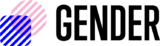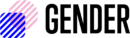1. Ausgewählte Entscheidungen
O.H. und G.H. gegen Deutschland / A.H. und andere gegen Deutschland, April 2023
Sachverhalt:
In einem der beiden Fälle hatte eine Trans-Frau unter Berufung auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gefordert, als Mutter des mit ihrem Samen gezeugten Kindes amtlich eingetragen zu werden. Das zuständige Standesamt entschied, die als Mann geborene Klägerin nicht als Mutter in das Geburtenregister einzutragen, da sie das Kind nicht geboren habe. Stattdessen wird jene Person als Mutter geführt, die das Kind tatsächlich zur Welt gebracht hat. Beide Elternteile klagten gegen dieses Vorgehen.
Im zweiten Fall ging es um die Beschwerde eines Trans-Mannes, der als „Vater“ seines Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen werden wollte. Der Kläger war als Frau geboren worden und hatte das Kind zur Welt gebracht, nachdem der Geschlechtswechsel von weiblich zu männlich bereits rechtlich anerkannt worden war. Zweitantragsteller im Verfahren war das geborene Kind.
Entscheidung:
Der EGMR entschied, dass es rechtens ist, die biologische Vater- oder Mutterschaft ins Geburtenregister einzutragen, auch wenn der Elternteil vor oder nach der Geburt die Geschlechtsidentität gewechselt habe. Rechtens ist auch die Eintragung der Elternteile mit den ursprünglichen Vornamen. Die Deutschen Gerichte hätten einen fairen Ausgleich zwischen den Rechten der Beschwerdeführer, den Kindeswohlerwägungen und dem öffentlichen Interesse gefunden.
Y. gegen Frankreich, 31.01.2023
Sachverhalt:
Eine intersexuelle Person wandte sich an die französischen Behörden, um ihre bei der Geburt erfolgte Eintragung als „männlich“ auf „neutral“ oder „intersexuell“ ändern zu lassen. Mit Berufung auf die Notwendigkeit eines zuverlässigen Personenstandsregisters wiesen die zuständige Behörde und auch das Berufungsgericht den Antrag ab. Die Person wandte sich daraufhin an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit der Beschwerde, in ihrem Recht auf Privat- und Familienleben gemäß Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzt worden zu sein.
Entscheidung:
Keine Verletzung von Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): In seinem Urteil wies der EGMR zuerst darauf hin, dass die Diskrepanz zwischen der biologischen und rechtlichen Identität Leid und Besorgnis beim Betroffenen hervorrufen könne. Die triftige Argumentation der französischen Behörde, dass der Grundsatz der Unabdingbarkeit des Personenstandes zu achten sei und die Beständigkeit und Zuverlässigkeit des Personenstandsregisters sowie der derzeit geltenden sozialen und rechtlichen Regelungen unbedingt gewahrt werden müssten, seien aber den Interessen des Beschwerdeführers entgegenzuhalten. Zudem zog der EGMR die Begründungen des Berufungsgerichts heran, nach denen die Anerkennung eines „neutralen Geschlechts“ weitreichende Konsequenzen für das französische Recht haben würde. Dieses basiere nämlich auf dem Grundsatz zweier Geschlechter. Eine Adaption dieses Grundsatzes würde mit etlichen damit zusammenhängenden Gesetzesänderungen einhergehen. Der EGMR führte weiters aus, dass die Einführung einer zusätzlichen „Genderkategorie“ Sache der Gesetzgebung und nicht der Gerichtsbarkeit sei und das nationale Gericht im Einklang mit dem Prinzip der Gewaltentrennung, ohne die es keine Demokratie gebe, agiert habe. Der EGMR kam daher zu dem Schluss, dass keine Verletzung des Rechts auf Privat- und Familienleben vorliege und es dem französischen Staat selbst überlassen bleiben müsse, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit er den Forderungen von intersexuellen Personen nachkommen wolle.
X. und Y. gegen Rumänen, 19.01.2021
Sachverhalt:
Die Kläger waren zur Zeit der Klageerhebung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Personenstandsregister als Frauen vermerkt. Beide versuchten eine Änderung ihres Geschlechtseintrags von „weiblich“ auf „männlich“ vor den nationalen Gerichten zu erwirken, wobei die als X bezeichnete Partei ärztliche Gutachten vorlegte, die das Vorhandensein einer Geschlechtsdysphorie bestätigten.
Die angerufenen rumänischen Gerichte lehnten die Anträge mit der Begründung ab, dass diese „verfrüht“ seien und forderten die Antragsteller auf, eine Bestätigung über eine geschlechtsumwandelnde Operation vorzulegen.
Ein Jahr nach Anrufung des EGMR unterzog sich einer der Kläger (Y) einer geschlechtsumwandelnden Operation und beantragte erneut eine Änderung des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister in Rumänien, die diesmal von den Gerichten autorisiert wurde, wobei ihm ein neuer Personalausweis ausgestellt, der Vorname geändert und eine neue Identitätsnummer zugeteilt wurde. Das Gericht ordnete zudem eine Änderung im Personenstandsregister und die Ausstellung einer neuen Geburtsurkunde an.
Entscheidung:
Verletzung von Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): Die nationalen Gerichte hätten im gegenständlichen Fall einerseits aufgrund detaillierter Informationen wie einer erfolgten Hormontherapie und Brustentfernung die Kläger als transgender anerkannt, andererseits hätten sie den Betroffenen eine Änderung des Geschlechtseintrags aufgrund der fehlenden geschlechtsumwandelnden Operation mit dem Hinweis verweigert, dass die Änderung aufgrund einer Selbstauskunft nicht erlaubt sei.
Der Gerichtshof hielt dazu fest, dass das nationale Recht in Rumänien kein etabliertes Verfahren zur Änderung der Geschlechtsidentität vorsehe. Die theoretische Möglichkeit, das Geschlecht vor den nationalen Gerichten ändern zu lassen, sei zwar vom rumänischen Verfassungsgerichtshof im Jahr 2008 anerkannt worden. Damit sei auch eine rechtliche Basis zur Änderung des Geschlechts in Rumänien vorhanden. Diese sei jedoch in Bezug auf die Voraussetzungen, die für eine Änderung der Geschlechtsidentität zu erfüllen seien, nach Ansicht des Gerichtshofs zu vage und unbestimmt. Es gebe in Rumänien in Bezug auf das Erfordernis einer geschlechtsumwandelnden Operation auch keine einheitliche Rechtsprechung, zumal eine Änderung der Geschlechtsidentität in einigen Fällen auch ohne die Bestätigung über eine durchgeführte Operation von Gerichten bewilligt wurde. Damit sei das Verfahren unklar und unvorhersehbar.
Die nationalen Gerichte hätten dabei keine triftigen Gründe für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses, das der Änderung des Geschlechtseintrags im konkreten Fall entgegenstünde, vorgebracht und auch keine adäquate Interessensabwägung zwischen einem wie auch immer gearteten öffentlichem Interesse und dem Recht der Kläger auf Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität vorgenommen.
Die Vorgehensweise der rumänischen Gerichte hätte die Kläger dadurch in einen „unzumutbar langen, schmerzlichen Zustand versetzt, der in ihnen Gefühle der Verletzlichkeit, Demütigung und Angst“ hervorrufen konnte. Die Kläger wären durch die nationalen Gerichte außerdem vor ein unlösbares Dilemma gestellt worden: durch eine geschlechtsumwandelnde Operation hätten sie entweder auf ihr Recht auf Achtung der physischen Integrität oder im umgekehrten Fall auf das Recht auf Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität verzichten müssen – beides aus Art. 8 EMRK abgeleitete Grundrechte. Damit hätten die nationalen Gerichte keinen fairen Ausgleich zwischen dem öffentlichen Interesse und dem individuellen Interesse der Betroffenen geschaffen.
Aufgrund des Fehlens von klaren und vorhersehbaren Verfahren, die eine rasche, transparente und leicht zugängliche Änderung des Namens und der Geschlechtseintragung in offiziellen Dokumenten ermöglichen würden, sei im gegenständlichen Fall daher das sich aus Art. 8 EMRK ableitende Recht der Betroffenen auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens von den rumänischen Gerichten verletzt worden.
Quelle: IEF-Politblog
2. Aus dem Informationsblatt zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Oktober 2011
Rees gegen Vereinigtes Königreich, 17.10.1986
Sachverhalt:
Ein Frau-zu-Mann-Transsexueller rügte, dass seine Geschlechtsumwandlung nicht vollständig rechtlich anerkannt werde.
Entscheidung:
Keine Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): Die vom Beschwerdeführer verlangten rechtlichen Änderungen hätten grundlegende Änderungen in der Führung des Geburtenregisters notwendig gemacht – mit weitreichenden Folgen für die Verwaltung. Der Gerichtshof maß außerdem dem Umstand Bedeutung zu, dass das Vereinigte Königreich die Kosten für die medizinische Behandlung des Beschwerdeführers getragen hatte.
Gleichwohl war sich der Gerichtshof „des Ernstes der Probleme und der Not von Transsexuellen“ bewusst und empfahl, „die Notwendigkeit angemessener Maßnahmen weiter zu beobachten, insbesondere im Hinblick auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen“.
Keine Verletzung von Artikel 12 EMRK (Recht auf Eheschließung und Familiengründung):
Das traditionelle Verständnis der Ehe beruht auf einer Verbindung von Personen verschiedenen Geschlechts. Die Staaten haben die Kompetenz, das Recht zur Eheschließung zu regeln.
Cossey gegen Vereinigtes Königreich, 27.09.1990
Der Gerichtshof kam zu ähnlichen Schlüssen wie in Rees gegen Vereinigtes Königreich und fand keine neuen besonderen Umstände, die zu einer Abweichung von seinem früheren Urteil geführt hätten.
Keine Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): Der Gerichtshof unterstrich, dass „eine geschlechtsanpassende Operation nicht den Erwerb aller biologischen Merkmale des anderen Geschlechts nach sich zieht“ (Abs 40).
Keine Verletzung von Artikel 12 EMRK (Recht auf Eheschließung und Familiengründung): Die Bindung an das traditionelle Verständnis von Ehe bietet „ausreichende Gründe für die weitere Zugrundelegung biologischer Kriterien zur Geschlechtsbestimmung einer Person im Hinblick auf die Eheschließung“. Es ist Sache der Staaten, die Ausübung des Rechts auf Eheschließung zu regeln.
B. gegen Frankreich, 25.03.1992
Sachverhalt:
Eine Mann-zu-Frau Transsexuelle, Frau B., rügte die Weigerung der französischen Behörden, das Personenstandsregister ihren Wünschen entsprechend zu ändern.
Entscheidung:
Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): Der Gerichtshof berücksichtigte Umstände, die den Fall von Rees gegen Vereinigtes Königreich und Cossey gegen Vereinigtes Königreich unterschieden, insbesondere die Unterschiede zwischen dem britischen und französischen System der Eintragung des Personenstandes. Während es im Vereinigten Königreich erhebliche Hürden für die Änderung von Geburtsurkunden gab, war es in Frankreich vorgesehen, Geburtsurkunden im Laufe des Lebens zu ändern. Der Gerichtshof stellte fest, dass in Frankreich viele offizielle Dokumente „eine Diskrepanz zwischen rechtlichem und offenkundigem Geschlecht eines Transsexuellen“ (Abs 59) offenbaren, was auch die Angaben in Sozialversicherungsdokumenten und Gehaltsabrechnungen betrifft.
Der Gerichtshof entschied folglich, dass die Weigerung, den Eintrag der Beschwerdeführerin im Personenstandsregister zu ändern, sie „täglich in eine Situation [brachte], die nicht mit der Achtung ihres Privatlebens vereinbar ist“.
X, Y und Z gegen Vereinigtes Königreich, 22.04.1997
Der Gerichtshof kam zwar zu dem Schluss, dass keine Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) vorlag, erkannte aber das Bestehen eines Familienlebens zwischen einem Transsexuellen und dem Kind seiner Partnerin an (Abs 37: „X hat sich seit der Geburt in jeder Hinsicht wie der „Vater“ von Z verhalten. Unter solchen Umständen ist der Gerichtshof der Auffassung, dass [de facto] eine Familienbindung zwischen den drei Beschwerdeführern besteht.“)
Sheffield und Horsham gegen Vereinigtes Königreich, 30.07.1998
Der Gerichtshof befand, dass es keinen Grund gab, von seinen Urteilen in Rees gegen Vereinigtes Königreich und Cossey gegen Vereinigtes Königreich abzuweichen: „Transsexualität wirft weiterhin wissenschaftliche, rechtliche, moralische und soziale Probleme auf, denen die Vertragsstaaten nicht mit einer grundlegenden gemeinsamen Herangehensweise begegnen“ (Abs 58).
Keine Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens), 12 EMRK (Recht auf Eheschließung und Familiengründung) und 14 EMRK (Diskriminierungsverbot): Gleichwohl „unterstreicht der Gerichtshof erneut, dass Entwicklungen in diesem Bereich weiterhin von den Vertragsstaaten beobachtet werden müssen“ (Abs 60) und dies im Zusammenhang mit „der zunehmenden sozialen Akzeptanz des Phänomens und der zunehmenden Anerkennung der Probleme, denen postoperative Transsexuelle ausgesetzt sind“.
Christine Goodwin gegen Vereinigtes Königreich, Urteil der Großen Kammer, 11.07.2002
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin rügte, dass ihre Geschlechtsumwandlung rechtlich nicht anerkannt werde, insbesondere hinsichtlich ihrer Beschäftigungsbedingungen, hinsichtlich ihrer Sozialversicherungs- und Rentenrechte und da ihr das Recht auf Eheschließung verwehrt werde.
Entscheidung:
Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): Aufgrund der deutlichen internationalen Tendenz zu einer zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz von Transsexuellen und zur rechtlichen Anerkennung von Geschlechtsumwandlungen.
„Da es keine wichtigen Gründe des öffentlichen Interesses gibt, die dem Interesse der Beschwerdeführerin auf rechtliche Anerkennung ihrer Geschlechtsumwandlung entgegenstehen, kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass die gerechte Abwägung, die der Konvention immanent ist, nun eindeutig zu Gunsten der Beschwerdeführerin vorgenommen werden muss.“
Verletzung von Artikel 12 EMRK (Recht auf Eheschließung und Familiengründung): „Der Gerichtshof ist nicht davon überzeugt, dass auch heute noch angenommen werden kann, dass [Artikel 12] sich auf eine Geschlechtsbestimmung nach rein biologischen Kriterien beziehen muss.“ (Abs 100)
Der Gerichtshof befand, dass es dem Staat zusteht, die Voraussetzungen und Formalitäten von Eheschließungen Transsexueller zu regeln, dass er aber „keine Rechtfertigung dafür sieht, Transsexuellen in jedem Fall das Recht auf Eheschließung zu versagen“.
Nach dem Urteil der Großen Kammer im Fall Christine Goodwin führte das Vereinigte Königreich 2004 eine Regelung ein, nach der Transsexuelle eine amtliche Bestätigung über die Anerkennung des Geschlechts beantragen können.
R. und F. gegen Vereinigtes Königreich, November 2006
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführer waren beide verheiratet und hatten Kinder. Beide hatten eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen und blieben mit ihrem jeweiligen Ehepartner zusammen. Nach dem Gesetz von 2004 über die Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit beantragten beide die Ausstellung einer amtlichen Bescheinigung über die Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit, die sie aber nur durch Beendigung ihrer Ehe hätten bekommen können. Sie machten eine Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) und 12 EMRK (Recht auf Eheschließung), geltend.
Entscheidung:
Beschwerden für unzulässig erklärt (abgewiesen als offensichtlich unbegründet): Von den Beschwerdeführern wurde verlangt, ihre Ehen zu beenden, weil gleichgeschlechtliche Ehen nach englischem Recht nicht erlaubt waren. Das Vereinigte Königreich hatte die rechtliche Anerkennung von Geschlechtsumwandlungen möglich gemacht und die Beschwerdeführer hatten die Möglichkeit, ihre Beziehung fortzuführen und als Lebenspartnerschaft eintragen zu lassen, die fast die gleichen Rechte und Pflichten umfasste wie die Ehe.
Der Gerichtshof stellte fest, dass der Gesetzgeber von der kleinen Anzahl von verheirateten Transsexuellen wusste, als er die neue Regelung einführte, aber bewusst keine Sonderregelung für diese Ehen vorsah. Der Gerichtshof war der Auffassung, dass nicht verlangt werden konnte, diese geringe Zahl von Fällen gesondert zu berücksichtigen.
Schlumpf gegen die Schweiz, 08.01.2009
Sachverhalt:
Weigerung der Krankenversicherung der Beschwerdeführerin, die Kosten für eine Geschlechtsumwandlung zu übernehmen, weil sie vor der Operation nicht zwei Jahre abgewartet hatte, wie von der Rechtsprechung vorgesehen.
Entscheidung:
Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): Die Wartezeit wurde automatisch zugrunde gelegt, ohne das Alter der Beschwerdeführerin (67 Jahre) zu berücksichtigen.
P.V. gegen Spanien, 30.11.2010
Sachverhalt:
Eine Mann-zu-Frau Transsexuelle bekam vor ihrer Geschlechtsumwandlung 1998 einen Sohn mit ihrer Ehefrau. Im Jahr 2002 trennte sich das Paar und die Beschwerdeführerin rügte nun die gerichtlichen Einschränkungen ihres Umgangsrechts mit ihrem Sohn mit der Begründung, dass ihre emotionale Unausgeglichenheit nach der Geschlechtsumwandlung auf das Kind verstörend wirken könne.
Entscheidung:
Keine Verletzung von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) in Verbindung mit Artikel 14 EMRK (Diskriminierungsverbot): Die Einschränkungen des Umgangsrechts stellten keine Diskriminierung aufgrund der Transsexualität der Beschwerdeführerin dar. Der entscheidende Grund für die von den spanischen Gerichten auferlegten Einschränkungen war angesichts der vorübergehenden emotionalen Unausgeglichenheit der Beschwerdeführerin das Kindeswohlinteresse. Sie legten daher eine Regelung fest, die es dem Kind ermöglichen würde, sich schrittweise an die Geschlechtsumwandlung seines Vaters zu gewöhnen.
P. gegen Portugal, aus dem Register gestrichen am 06.09.2011
Sachverhalt:
Bei ihrer Geburt wurde die Beschwerdeführerin als männlich registriert. Mit Erreichen des Erwachsenenalters unterzog sie sich einer Geschlechtsumwandlung. Sie rügte die fehlende rechtliche Anerkennung ihrer Situation, da es in Portugal keine entsprechende Gesetzgebung gebe. Es handelt sich um die erste Beschwerde dieser Art vor dem Gerichtshof gegen Portugal. Die Forderung der Beschwerdeführerin nach rechtlicher Anerkennung war vor den nationalen Gerichten erfolgreich, deshalb entschied der Gerichtshof, die Beschwerde aus seinem Register zu streichen.
| männlich | Männer bzw. Trans-Männer |
| weiblich | Frauen bzw. Trans-Frauen |
| inter | nur intersexuelle Personen |
| divers | nur intersexuelle Personen |
| offen | nur Neugeborene, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen |
| Streichung des Geschlechtseintrags | nur intersexuelle Personen |
Am 22. April 2015 stimmte die Mehrheit der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für die Resolution 2048 mit dem Titel „Diskriminierung von Transgender-Personen in Europa“. Die Resolution ist nicht rechtsverbindlich und ist daher als politische Absichtserklärung zu verstehen.
Der Europarat fordert in der Resolution 2048 unter anderem:
- Nationale Anti-Diskriminierungsgesetze auf Grundlage der geschlechtlichen Identität
- Internationale Menschenrechtsnormen ohne Diskriminierung der geschlechtlichen Identität
- Gesetze gegen Hassverbrechen zur Ahndung transphober Vergehen
- Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität beim Zugang zu einer Beschäftigung im privaten und öffentlichen Sektor, beim Zugang zu Wohnraum, zur Justiz und Gesundheitsversorgung
- Schnelle, transparente und leicht zugängliche Verfahren auf der Grundlage der Selbstbestimmung zur Änderung des Geschlechtseintrags in offiziellen Dokumenten
- Absehen von dem Erfordernis eines Nachweises über medizinische Behandlungen und Operationen, psychologische Gutachten sowie vom Erfordernis der Scheidung von aufrechten Ehen
- Streichung der Genderinkongruenz aus nationalen und internationalen Klassifizierungen von Krankheiten
- Sicherstellung und Übernahme durch gesetzliche Krankenversicherungen der Kosten der psychologischen und medizinischen Behandlungen
Quelle: Assembly.coe.int
Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts. Ziel der Europäischen Union (EU) im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern ist es zum einen, Chancengleichheit und Gleichbehandlung zu gewährleisten. Zum anderen zielt die EU darauf ab, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu unterbinden. Bei Gender Mainstreaming geht es darum, sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen so zu gestalten, dass die etwaigen Auswirkungen auf die Situation von Frauen und Männern bereits in der Konzeptionsphase aktiv und erkennbar integriert werden („gender perspective“). Die zentralen Gleichstellungsziele der EU sind:
- Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit
- Gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit
- Gleichstellung in Entscheidungsprozessen
- Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt
- Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in der Welt
Quelle: Europäische Kommission
Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen 2020-2025
Die Strategie zur Gleichstellung von LGBTIQ stellt eine neue Phase in den Bemühungen der EU um die Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, nichtbinären, intersexuellen und queeren Personen dar. Der Schwerpunkt dabei liegt weiterhin auf vorrangigen Bereichen, wie sie in den vier Säulen unterhalb dargelegt werden. Darüber hinaus wird betont, dass eine Dimension zur Gleichstellung von LGBTIQ in alle Politikbereiche und Finanzierungsprogramme der EU aufgenommen werden muss.
Die Strategie legt eine Reihe von gezielten Maßnahmen in insgesamt vier Säulen fest:
1. Bekämpfung der Diskriminierung von LGBTIQ-Personen
- Förderung der Inklusion und Vielfalt am Arbeitsplatz
- Bekämpfung der Ungleichheit in Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport
- Wahrung der Rechte von LGBTIQ, die internationalen Schutz beantragen
2. Gewährleistung der Sicherheit von LGBTIQ-Personen
- Verstärkung des rechtlichen Schutzes von LGBTIQ-Personen vor Hassdelikten, Hetze und Gewalt
- Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung von gegen LGBTIQ gerichtete Hetze und Desinformation
- Meldung von Hassdelikten gegen LGBTIQ und Austausch bewährter Verfahren
- Schutz und Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit von LGBTIQ-Personen
3. Aufbau von Gesellschaften, die LGBTIQ einschließen
- Sicherstellen der Rechte von LGBTIQ-Personen in grenzüberschreitenden Fällen
- Verbesserung des rechtlichen Schutzes für Regenbogenfamilien in grenzüberschreitenden Situationen
- Verbesserung der Anerkennung von trans* und nichtbinären Identitäten und von intersexuellen Personen
- Förderung eines positiven Umfelds für die Zivilgesellschaft
4. Führungsrolle bei der Forderung nach der Gleichstellung von LGBTIQ in der ganzen Welt
- Stärkung des Engagements der EU in Bezug auf Probleme von LGBTIQ in all ihren Außenbeziehungen
Die Yogyakarta Prinzipien wurden im Anschluss an das Treffen der Vertreter verschiedener NGOs und einiger UN Vertragsorgane sowie mehrerer UN Sonderberichterstatter, das vom 6. bis 9. November 2006 in Yogyakarta (Indonesien) stattfand, verabschiedet. 2007 wurden sie während einer Veranstaltung der Zivilgesellschaft im Rahmen der 62. Generalversammlung der Vereinten Nationen präsentiert. Die Yogyakarta Prinzipien sind rechtlich nicht bindend und bilden nicht das geltende Völkerrecht ab. Sie wurden von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen weder verhandelt noch anerkannt. Unterzeichnet wurden sie von lediglich 29 Experten aus 25 Ländern.
Laut Eigenbeschreibung stellen die darin ausgeführten 29 Prinzipien und dazugehörigen Empfehlungen, „die Anwendung der internationalen Menschenrechte auf das Leben und die Erfahrungen von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten dar“.
Unter „sexueller Orientierung“ und „geschlechtlicher Identität“ verstehen die Yogyakarta Prinzipien folgendes:
„Sexuelle Orientierung“ ist die „Fähigkeit eines Menschen, sich emotional und sexuell intensiv zu Personen desselben oder eines anderen Geschlechts (gender) oder mehr als einen Geschlechts (gender) hingezogen zu fühlen und vertraute und sexuelle Beziehungen mit ihnen zu führen“.
„Geschlechtliche Identität“ ist das „tief empfundene innere und persönliche Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht (gender), das mit dem Geschlecht (sex), das dem betroffenen Menschen bei seiner Geburt zugewiesen wurde, übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Dies schließt die Wahrnehmung des eigenen Körpers mit ein (darunter auch die freiwillige Veränderung des äußeren körperlichen Erscheinungsbildes oder der Funktionen des Körpers durch medizinische, chirurgische oder andere Eingriffe) sowie andere Ausdrucksformen des Geschlechts (gender), z.B. durch Kleidung, Sprache und Verhaltensweisen“.
Die Yogyakarta Prinzipien umfassen Rechte – teilweise als Rechte deklarierten Forderungen -, wie das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, das Recht auf Sicherheit und Schutz vor jeglicher Form von Gewalt und Übergriffen im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität und das Recht auf Schutz der Privatsphäre unabhängig von der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Neben der Bekämpfung von Gewalt und strafrechtlicher Verfolgung von Homosexualität umfassen die Yogyakarta Prinzipien jedoch auch Rechte, wie das Recht auf Arbeit, auf angemessenen Wohnraum, auf Bildung, auf das höchstmögliche Maß an Gesundheit, auf Meinungs- und Äußerungsfreiheit oder auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit – immer im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität.
Die einzelnen Prinzipien lauten:
- Prinzip 01. Das Recht auf universellen Genuss der Menschenrechte
- Prinzip 02. Das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung
- Prinzip 03. Das Recht auf Anerkennung vor dem Gesetz
- Prinzip 04. Das Recht auf Leben
- Prinzip 05. Das Recht auf persönliche Sicherheit
- Prinzip 06. Das Recht auf Schutz der Privatsphäre
- Prinzip 07. Das Recht auf Schutz vor willkürlicher Freiheitsentziehung
- Prinzip 08. Das Recht auf ein faires Verfahren
- Prinzip 09. Das Recht auf menschenwürdige Haftbedingungen
- Prinzip 10. Das Recht auf Freiheit von Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
- Prinzip 11. Das Recht auf Schutz vor allen Formen der Ausbeutung, vor dem Verkauf von Menschen und vor Menschenhandel
- Prinzip 12. Das Recht auf Arbeit
- Prinzip 13. Das Recht auf soziale Sicherheit und andere soziale Schutzmaßnahmen
- Prinzip 14. Das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard
- Prinzip 15. Das Recht auf einen angemessenen Wohnraum
- Prinzip 16. Das Recht auf Bildung
- Prinzip 17. Das Recht auf das höchstmögliche Maß an Gesundheit
- Prinzip 18. Das Recht auf Schutz vor medizinischer Misshandlung
- Prinzip 19. Das Recht auf Meinungs- und Äußerungsfreiheit
- Prinzip 20. Das Recht zur friedlichen Versammlung und Vereinigung
- Prinzip 21. Das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
- Prinzip 22. Das Recht auf Freizügigkeit
- Prinzip 23. Das Recht Asyl zu suchen
- Prinzip 24. Das Recht auf Gründung einer Familie
- Prinzip 25. Das Recht auf Teilhabe am öffentlichen Leben
- Prinzip 26. Das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben
- Prinzip 27. Das Recht auf die Förderung von Menschenrechten
- Prinzip 28. Das Recht auf wirksamen Rechtsschutz und Wiedergutmachung
- Prinzip 29. Verantwortlichkeit
Kritik
Im Folgenden sollen exemplarisch einige Prinzipien herausgegriffen und kommentiert werden.
Prinzip 2: Das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung
„Alle Menschen haben Anspruch auf den Genuss aller Menschenrechte ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Alle Menschen haben Anspruch auf Gleichheit vor dem Gesetz und gleichen Schutz durch das Gesetz ohne derartige Diskriminierung und unabhängig davon, ob dies den Genuss eines anderen Menschenrechts berührt. Das Gesetz sollte jegliche Form der Diskriminierung verbieten und allen Menschen gleichermaßen wirksamen Schutz vor derartiger Diskriminierung garantieren. (…)
DIE STAATEN MÜSSEN
(…)
C. entsprechende gesetzgeberische und weitere Maßnahmen ergreifen, um Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität im öffentlichen wie im privaten Bereich zu verbieten und abzuschaffen; (…)“
Prinzip 2 erklärt die moralischen Kriterien zum Umgang mit Sexualität als „Diskriminierung“. Zugleich verlangt das Prinzip 2, dass andere Menschenrechte, die damit in Konflikt stehen, als nachrangig betrachtet werden sollen – wie etwa das Recht auf Privatleben, das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das Recht auf Eigentum sowie das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit.
Prinzip 3: Recht auf Anerkennung vor dem Gesetz
„Jeder Mensch hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität müssen in allen Lebensbereichen in den Genuss der Rechtsfähigkeit kommen. Die selbstbestimmte sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität jedes Menschen ist fester Bestandteil seiner Persönlichkeit und eines der grundlegenden Elemente von Selbstbestimmung, Würde und Freiheit. (…) Kein rechtlicher Stand, wie beispielsweise die Ehe oder die Elternschaft, darf als Grund angeführt werden, um die rechtliche Anerkennung der geschlechtlichen Identität eines Menschen zu verhindern. Es darf auf keinen Menschen Druck ausgeübt werden, seine sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität zu verbergen, zu unterdrücken oder zu verleugnen.
DIE STAATEN MÜSSEN
(…)
B. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, damit die selbstbestimmte geschlechtliche Identität jedes Menschen in vollem Umfang geachtet und rechtlich anerkannt wird;
C. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass es Verfahren gibt, durch die auf allen vom Staat ausgegebenen persönlichen Dokumenten, in denen das Geschlecht (gender/sex) eines Menschen angegeben wird – z.B. Geburtsurkunden, Reisepässe, Wählerverzeichnisse usw. – die von der betroffenen Person selbst bestimmte geschlechtliche Identität genannt wird; (…)“
Wie erwähnt, ist die „geschlechtliche Identität“ in diesem Sinne gefühlsabhängig und variabel. Probleme, die durch einen „selbstbestimmten“ Geschlechtseintrag entstehen können und die damit in Verbindung stehenden Diskriminierungsverbote, sind vielfältig. Wenn sich beispielsweise ein verheirateter Mann dazu entschließen würde, als Frau leben zu wollen und die Ehefrau daran Anstoß nähme und sich aufgrund dessen scheiden lassen wollte, könnte dies gemäß der YP eine Diskriminierung darstellen.
Prinzip 16: Das Recht auf Bildung
„DIE STAATEN MÜSSEN
(…)
D. sicherstellen, dass die Lehrmethoden, Lehrpläne und Lehrmaterialien dazu geeignet sind, Verständnis und Respekt unter anderem für unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten zu fördern, wobei die damit in Zusammenhang stehenden besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden sowie ihrer Eltern und Familienangehörigen einbezogen werden; (…)“
Eltern sind als erste Erziehungsberechtigte verantwortlich für ihre Kinder (vgl Übereinkommen über die Rechte des Kindes Art 5 und 18). Diese Verantwortung umfasst auch die Weitergabe von Werten. Gemäß Art 2 EMRK hat der Staat bei Ausübung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen. Eine Sexualpädagogik, die beispielsweise postuliert, dass es keine biologische Geschlechtlichkeit gibt und damit Werte wie die beständige Treue zwischen Mann und Frau und den Zusammenhang mit der Weitergabe des Lebens verneint, kann diesem Recht der Eltern widersprechen.
In Prinzip 19 „Das Recht auf Meinungsfreiheit und Äußerungsfreiheit“ und Prinzip 20 „Das Recht zur friedlichen Versammlung und Vereinigung“ werden Sonderrechte für LGBTI*-Aktivismus gefordert. Diese Rechte dürften „nicht eingeschränkt werden durch sonst allgemeingültige Normen der „öffentlichen Ordnung, öffentlichen Moral, öffentlichen Gesundheit und öffentlichen Sicherheit“. Es wird das Recht gefordert, „Informationen und Gedankengut jeglicher Art mittels aller Medien und ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“
„DIE STAATEN MÜSSEN alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, (…)
B. dass die Produkte und Organisation staatlich kontrollierter Medien in Hinblick auf Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität pluralistisch und nicht-diskriminierend gestaltet sind; (…)
E. dass durch die Wahrnehmung der Rede- und Äußerungsfreiheit nicht die Rechte und Freiheiten von Personen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten verletzt werden; (…)“
Würde das Prinzip 20 akzeptiert, dann wären Vereinigungen, Versammlungen und Demonstrationen, welche den LGBTI*-Lebensstil propagieren, die einzigen, welche keiner Begrenzung durch die öffentliche Ordnung und Moral unterworfen wären. So dürften LGBTI*-Aktivisten Personen, die ihre Ansichten nicht teilten, beleidigen oder provozieren. Eine solche Privilegierung wäre nicht mit den demokratischen Prinzipien vereinbar.
Prinzip 24: Recht auf Gründung einer Familie
„Jeder Mensch hat unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität das Recht, eine Familie zu gründen. Es gibt die unterschiedlichsten Formen von Familien. Keine Familie darf aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität eines ihrer Mitglieder diskriminiert werden.
DIE STAATEN MÜSSEN
A. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um das Recht auf Gründung einer Familie ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität zu gewährleisten. Dies gilt auch für den Zugang zu Adoption und medizinisch unterstützter Fortpflanzung (einschließlich Samenspenden); (…)
C. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass (…) das Kindeswohl stets im Vordergrund steht und die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität des Kindes oder eines anderen Familienangehörigen oder einer anderen Person nicht als unvereinbar mit dem Kindeswohl gelten;
D. bei sämtlichen Handlungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit Kindern sicherstellen, dass Kinder, die sich eine persönliche Meinung bilden können, von dem Recht Gebrauch machen können, diese Meinung frei zu äußern, und dass diese Meinung entsprechend dem Alter und der Reife des Kindes gebührend berücksichtigt wird; (…)“
Jedes Kind hat das Recht bei seinen Eltern zu leben und von beiden Elternteilen erzogen zu werden, es sei denn, dies würde das Kindeswohl gefährden (vgl Übereinkommen über die Rechte des Kindes Art 7, 9 und 18). Die Eltern sind verantwortlich für das Kindeswohl. Das Recht des Kindes auf seine Eltern wird durch die YP auf ein Recht Erwachsener auf ein Kind verkehrt. Gemäß Europäischer Menschenrechtskonvention (EMRK) hat ein Mensch das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung, was aus Art 8, dem Recht auf Privatleben abgeleitet wird (vgl ebenso Übereinkommen über die Rechte des Kindes Art 7). Das Kindeswohl muss gemäß der UN-Kinderrechtskonvention immer als vorrangiges Ziel staatlicher Maßnahmen gesehen werden. Durch reproduktionsmedizinische Maßnahmen, die zur Folge haben, dass das Kind entweder seine Eltern nicht kennt (z.B. anonyme Eizell- oder Samenspende, Leihmutterschaft) oder nicht bei seinen beiden Elternteilen aufwachsen kann, führt zu einer Verletzung des Kindeswohls. In den YP wird von einem ein Recht auf Gründung einer Familie durch die Nutzung von reproduktionsmedizinischen Maßnahmen (da es auf natürlichem Weg nicht möglich ist), unabhängig des Geschlechts oder der Familienverhältnisse gesprochen. Eine Einschränkung dieses „Rechts“ wird im Sinne der YP als „Diskriminierung“ eingeordnet und soll entsprechend sanktioniert werden. Zwar betonen die YP den Vorrang des Kindeswohls, wobei aber von vornherein wesentliche Elemente des Kindeswohls ausgeklammert werden.
Prinzip 27: Das Recht auf die Förderung von Menschenrechten
„Jeder Mensch hat ohne Diskriminierung aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität das Recht, allein oder gemeinsam mit anderen den Schutz und die Durchsetzung von Menschenrechten auf nationaler und internationaler Ebene zu fördern. Hierzu gehören auch Aktivitäten, die auf die Förderung und die Verteidigung der Rechte von Personen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten abzielen, sowie das Recht, neue Menschenrechtsnormen auszuarbeiten, zu erörtern und für deren Anerkennung einzutreten.
DIE STAATEN MÜSSEN
A. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um ein positives Umfeld für Aktivitäten zur Förderung, Verteidigung und Verwirklichung von Menschenrechten zu schaffen, darunter auch von Menschenrechten, die sich auf die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität beziehen; (…)
C. sämtliche geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung von Handlungen oder Kampagnen ergreifen, die gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger, die sich mit Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität befassen, sowie gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten gerichtet sind;
D. sicherstellen, dass Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger, die sich mit Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität befassen, vor jeder Art von Gewalt, Bedrohungen, Vergeltungsaktionen, de facto oder de jure vorhandener Diskriminierung, Druck oder anderen willkürlichen Handlungen von Seiten des Staates oder nichtstaatlicher Akteure in Reaktion auf ihre Menschenrechtsaktivitäten geschützt sind. (…)“
Wie aus Prinzip 27 hervorgeht, geht es nicht nur um die Einhaltung der Menschenrechte, sondern um deren Weiterentwicklung. Dass das Recht sich weiterentwickelt, ist erforderlich. Die Frage ist allerdings, wer die Kompetenz hat, das Recht weiterzuentwickeln. Ein weiterer zu hinterfragender Punkt ist die Einhaltung der geforderten Maßnahmen wie in Prinzip 27 gefordert. Es braucht hier eine Art Überwachungsorgan, die die Staaten kontrolliert. Diese Funktion üben die „Monitoring Bodies“ der UN und die „Grundrechteagentur“ der EU aus.
Prinzip 29: Verantwortlichkeit
„Jede Person, deren Menschenrechte einschließlich der in den vorliegenden Prinzipien angesprochenen Rechte verletzt wurden, hat Anspruch darauf, dass diejenigen, die direkt oder indirekt für diese Rechtsverletzung verantwortlich sind, unabhängig davon, ob es sich um Behördenvertreter handelt oder nicht, auf eine Art und Weise für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden, die der Schwere der Rechtsverletzung angemessen ist. Es darf keine Straffreiheit für Personen geben, die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität begehen.
DIE STAATEN MÜSSEN
A. (…) Überwachungsmechanismen schaffen, um dafür zu sorgen, dass Personen, die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität begehen, zur Verantwortung gezogen werden können;
B. sicherstellen, dass (…) die Verantwortlichen bei entsprechender Beweislage strafrechtlich verfolgt, vor Gericht gestellt und angemessen bestraft werden;
C. unabhängige und wirksame Institutionen und Verfahren für die Überwachung der Erarbeitung und Umsetzung von Gesetzen und Maßnahmen schaffen, um die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität sicherzustellen; (…)“
Zu den YP gibt der „Activist´s Guide to The Yogyakarta Principes (AG)“ konkrete Handlungsanweisungen und -empfehlungen für „LGBTI*-Aktive und Interessierte“. Das Handbuch empfiehlt konkrete Umsetzungsstrategien bei der Umsetzung der YP. Juristisch findet die Umsetzung der Prinzipien häufig über den Weg höchstrichterlicher Urteile Eingang in die nationalstaatliche Gesetzgebung – beziehungsweise auf EU-Ebene über den Europäischen Gerichtshof (EuGH) oder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Die als Rechte deklarierten Forderungen sind teilweise keine bestehenden Menschenrechte, sondern werden als solche bezeichnet und dadurch von der breiten Öffentlichkeit angenommen und akzeptiert.
Finanziert werden die LGBTI+-Projekte durch offizielle Unterorganisationen der UN und EU sowie durch private Stiftungen/Geldgeber. Die „International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association“ (ILGA) finanziert sich hauptsächlich durch institutionelle Geldgeber wie öffentliche sowie private Einrichtungen. Im Jahr 2019 stammten 92 Prozent von ILGA-Europes Gesamtbudget aus Stipendien, 31 Prozent davon durch ein Stipendium der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission finanziert darüber hinaus Projekte der beiden weltweit größten Abtreibungsanbietern „Marie Stopes International“ und „International Planned Parenthood“.
Welche Ziele der Yogyakarta Prinzipien wurden in Österreich bereits erreicht?
Ehe für alle, Sexualpädagogische Programme an Schulen, Adoptionsrecht für homosexuelle Paare sowie reproduktionsmedizinische Maßnahmen für weibliche homosexuelle Paare.
Nächste Schritte: Leihmutterschaft – Vorstufe: Anerkennung der Elternschaft schon heute möglich, Verbot von Konversionstherapien bzw. non-affirmativen Beratungen (Deutschland, siehe YP 18), Levelling up – Antidiskriminierung „sexueller Minderheiten“ im Privatbereich
Quelle: Kuby Gabriele (2012), Die globale sexuelle Revolution, 1. Aufl., Kißleg, 107 ff. mwN.
Die YP + 10 wurden am 10. November 2017 verabschiedet. Das Dokument reflektiert Entwicklungen im Bereich internationaler Menschenrechtsnormen und schließt nun auch Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale als eigenständige Bereiche ein. Während in den YP eine ausführliche Berücksichtigung von Problemen intersexueller Menschen noch fehlte, kommt Verstößen auf Grundlage von Geschlechtsmerkmalen in den YP+10 nun zentrale Bedeutung zu. Beide Dokumente sind gemeinsam zu lesen – die YP + zehn korrigieren oder überschreiben die ursprünglichen YP nicht, sondern ergänzen sie.
Quellen:
www.boell.de
Hirschfeld-Eddy-Stiftung
Die International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI), die Youth and Student Organisation (IGLYO), die Nachrichtenagentur Thomas Reuters Foundation, Dentons und mehrere andere Rechtsanwaltskanzleien haben sich 2019 zusammengeschlossen und einen Leitfaden mit Best Practice und erfolgreichen Strategien zur Erleichterung einer rechtlichen Änderung des Geschlechts für unter 18-Jährige erstellt.
- Als Motiv für ihre Kooperation geben die Beteiligten unter anderem die psychische Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden minderjähriger Transgender-Personen an.
- Die Möglichkeit den Geschlechtseintrag zu ändern wird in dem Papier immer wieder als Menschenrecht, das jeder Transgender-Person zustehe und aus mehreren geltenden Menschenrechten abgeleitet werden könne, bezeichnet. Juristisch gesehen, gibt es aber keinen rechtsverbindlichen internationalen Vertrag oder darin enthaltene einzelne Bestimmungen, die sich ausschließlich an Transgender-Personen richten würden.
- Der Leitfaden sieht Kinder als selbständige Rechtssubjekte, die von ihrer Familie und ihren Eltern zu unterscheiden sind. Staaten seien daher dazu verpflichtet, gegen Eltern vorzugehen, wenn diese ihre Zustimmung zur rechtlichen Geschlechtsänderung oder zu Transgender-Behandlungen verweigern würden.
- Eine Muster-Rechtsordnung würde laut Leitfaden alle Transgender-Rechte auch auf Minderjährige ausweiten und das Erfordernis der elterlichen Zustimmung beschränken. Außerdem sollte eine Änderung der Geschlechtseintragung keine vorhergehende Sterilisation, Hormonbehandlung, geschlechtsumwandelnde Operation bzw. medizinische Diagnose erfordern.
- In Bezug auf Partnerschaften sollte die Änderung des Geschlechtseintrags keine Auswirkung auf den Status der Beziehung haben und ohne Einwilligung des Partners durchgeführt werden können.
- Der Leitfaden plädiert zudem für einen einfachen Zugang zu kostenlosen geschlechtsanpassenden Therapien.
1. Aktuellste Entscheidungen
O.H. und G.H. gegen Deutschland / A.H. und andere gegen Deutschland, April 2023
Sachverhalt:
In einem der beiden Fälle hatte eine Trans-Frau unter Berufung auf das Recht auf Achtung des gefordert, als Mutter des mit ihrem Samen gezeugten Kindes amtlich eingetragen zu werden. Das zuständige Standesamt entschied, die als Mann geborene Klägerin nicht als Mutter in das Geburtenregister einzutragen, da sie das Kind nicht geboren habe. Stattdessen wird jene Person als Mutter geführt, die das Kind tatsächlich zur Welt gebracht hat. Beide Elternteile klagten gegen dieses Vorgehen.
Im zweiten Fall ging es um die Beschwerde eines Trans-Mannes, der als „Vater“ seines Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen werden wollte. Der Kläger war als Frau geboren worden und hatte das Kind zur Welt gebracht, nachdem der Geschlechtswechsel von weiblich zu männlich bereits rechtlich anerkannt worden war. Zweitantragsteller im Verfahren war das geborene Kind.
Entscheidung:
EGMR entschied, dass es rechtens ist, die biologische Vater- oder Mutterschaft ins Geburtenregister einzutragen, auch wenn der Elternteil vor oder nach der Geburt die Geschlechtsidentität gewechselt habe. Rechtens ist auch die Eintragung der Elternteile mit den ursprünglichen Vornamen. Die Deutschen Gerichte hätten einen fairen Ausgleich zwischen den Rechten der Beschwerdeführer, den Kindeswohlerwägungen und dem öffentlichen Interessens gefunden.
Y. gegen Frankreich, 31.01.2023
Sachverhalt:
Eine intersexuelle Person wandte sich an die französischen Behörden, um ihre bei der Geburt erfolgte Eintragung als „männlich“ auf „neutral“ oder „intersexuell“ ändern zu lassen. Mit Berufung auf die Notwendigkeit eines zuverlässigen Personenstandsregisters wiesen die zuständige Behörde und auch das Berufungsgericht den Antrag ab. Die Person wandte sich daraufhin an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit der Beschwerde, in ihrem Recht auf Privat- und Familienleben gemäß Art 8 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzt worden zu sein.
Entscheidung:
Keine Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): in seinem Urteil wies der EGMR zuerst darauf hin, dass ihm bewusst sei, die Diskrepanz zwischen der biologischen und rechtlichen Identität Leid und Besorgnis beim Betroffenen hervorrufen könne. Die triftige Argumentation der französischen Behörde, dass der Grundsatz der Unabdingbarkeit des Personenstandes zu achten sei und die Beständigkeit und Zuverlässigkeit des Personenstandsregisters sowie der derzeit geltenden sozialen und rechtlichen Regelungen unbedingt gewahrt werden müssten, seien aber den Interessen des Beschwerdeführers entgegenzuhalten. Zudem zog der EGMR die Begründungen des Berufungsgerichts heran, nach denen die Anerkennung eines „neutralen Geschlechts“ weitreichende Konsequenzen für das französische Recht haben würde. Dieses basiere nämlich auf dem Grundsatz zweier Geschlechter. Eine Adaption dieses Grundsatzes würde mit etlichen damit zusammenhängenden Gesetzesänderungen einhergehen. Der EGMR führte weiters aus, dass die Einführung einer zusätzlichen „Genderkategorie“ Sache der Gesetzgebung und nicht der Gerichtsbarkeit sei und das nationale Gericht im Einklang mit dem Prinzip der Gewaltentrennung, ohne die es keine Demokratie gebe, agiert habe. Der EGMR kam daher zu dem Schluss, dass keine Verletzung des Rechts auf Privat- und Familienleben vorliege und es dem französischen Staat selbst überlassen bleiben müsse, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit er den Forderungen von intersexuellen Personen nachkommen wolle.
X. und Y. gegen Rumänen, 19.01.2021
Sachverhalt:
Die Kläger waren zur Zeit der Klageerhebung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Personenstandsregister als Frauen vermerkt. Beide versuchten eine Änderung ihres Geschlechtseintrags von „weiblich“ auf „männlich“ vor den nationalen Gerichten zu erwirken, wobei die als X bezeichnete Partei ärztliche Gutachten vorlegte, die das Vorhandensein einer Geschlechtsdysphorie bestätigten.
Die angerufenen rumänischen Gerichte lehnten die Anträge mit der Begründung ab, dass diese „verfrüht“ seien und forderten die Antragsteller auf, eine Bestätigung über eine geschlechtsumwandelnde Operation vorzulegen.
Ein Jahr nach Anrufung des EGMR unterzog sich einer der Kläger (Y) einer geschlechtsumwandelnden Operation und beantragte erneut eine Änderung des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister in Rumänien, die diesmal von den Gerichten autorisiert wurde, wobei ihm ein neuer Personalausweis ausgestellt, der Vorname geändert und eine neue Identitätsnummer zugeteilt wurde. Das Gericht ordnete zudem eine Änderung im Personenstandsregister und die Ausstellung einer neuen Geburtsurkunde an.
Entscheidung:
Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): die nationalen Gerichte hätten im gegenständlichen Fall einerseits aufgrund detaillierter Informationen wie einer erfolgten Hormontherapie und Brustentfernung die Kläger als transgender anerkannt, andererseits hätten sie den Betroffenen eine Änderung des Geschlechtseintrags aufgrund der fehlenden geschlechtsumwandelnden Operation mit dem Hinweis verweigert, dass die Änderung aufgrund einer Selbstauskunft nicht erlaubt sei.
Der Gerichtshof hielt dazu fest, dass das nationale Recht in Rumänien kein etabliertes Verfahren zur Änderung der Geschlechtsidentität vorsehe. Die theoretische Möglichkeit, das Geschlecht vor den nationalen Gerichten ändern zu lassen, sei zwar vom rumänischen Verfassungsgerichtshof im Jahr 2008 anerkannt worden. Damit sei auch eine rechtliche Basis zur Änderung des Geschlechts in Rumänien vorhanden. Diese sei jedoch in Bezug auf die Voraussetzungen, die für eine Änderung der Geschlechtsidentität zu erfüllen seien, nach Ansicht des Gerichtshofs zu vage und unbestimmt. Es gebe in Rumänien in Bezug auf das Erfordernis einer geschlechtsumwandelnden Operation auch keine einheitliche Rechtsprechung, zumal eine Änderung der Geschlechtsidentität in einigen Fällen auch ohne die Bestätigung über eine durchgeführte Operation von Gerichten bewilligt wurde. Damit sei das Verfahren unklar und unvorhersehbar.
Die nationalen Gerichte hätten dabei, keine triftigen Gründe für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses, das der Änderung des Geschlechtseintrags im konkreten Fall entgegenstünde, vorgebracht und auch keine adäquate Interessensabwägung zwischen einem wie auch immer gearteten öffentlichem Interesse und dem Recht der Kläger auf Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität vorgenommen.
Die Vorgehensweise der rumänischen Gerichte hätte die Kläger dadurch in einen „unzumutbar langen, schmerzlichen Zustand versetzt, der in ihnen Gefühle der Verletzlichkeit, Demütigung und Angst“ hervorrufen konnte. Die Kläger wären durch die nationalen Gerichte außerdem vor ein unlösbares Dilemma gestellt worden: durch eine geschlechtsumwandelnde Operation hätten sie entweder auf ihr Recht auf Achtung der physischen Integrität oder im umgekehrten Fall auf das Recht auf Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität verzichten müssen – beides aus Artikel 8 EMRK abgeleitete Grundrechte. Damit hätten die nationalen Gerichte keinen fairen Ausgleich zwischen dem öffentlichen Interesse und dem individuellen Interesse der Betroffenen geschaffen.
Aufgrund des Fehlens von klaren und vorhersehbaren Verfahren, die eine rasche, transparente und leicht zugängliche Änderung des Namens und der Geschlechtseintragung in offiziellen Dokumenten ermöglichen würden, sei im gegenständlichen Fall daher das sich aus Artikel 8 EMRK ableitende Recht der Betroffenen auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens von den rumänischen Gerichten verletzt worden.
Quelle: IEF-Politblog
2. Aus dem Informationsblatt zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Oktober 2011
Rees gegen Vereinigtes Königreich, 17.10.1986
Sachverhalt:
Ein Frau-zu-Mann-Transsexueller rügte, dass seine Geschlechtsumwandlung nicht vollständig rechtlich anerkannt werde.
Entscheidung:
Keine Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): die vom Beschwerdeführer verlangten rechtlichen Änderungen hätten grundlegende Änderungen in der Führung des Geburtenregisters notwendig gemacht – mit weitreichenden Folgen für die Verwaltung. Der Gerichtshof maß außerdem dem Umstand Bedeutung zu, dass das Vereinigte Königreich die Kosten für die medizinische Behandlung des Beschwerdeführers getragen hatte.
Gleichwohl war sich der Gerichtshof „des Ernstes der Probleme und der Not von Transsexuellen“ bewusst und empfahl, „die Notwendigkeit angemessener Maßnahmen weiter zu beobachten, insbesondere im Hinblick auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen“.
Keine Verletzung von Artikel 12 (Recht auf Eheschließung und Familiengründung):
Das traditionelle Verständnis der Ehe beruht auf einer Verbindung von Personen verschiedenen Geschlechts. Die Staaten haben die Kompetenz, das Recht zur Eheschließung zu regeln.
Cossey gegen Vereinigtes Königreich, 27.09.1990
Der Gerichtshof kam zu ähnlichen Schlüssen wie in Rees gegen Vereinigtes Königreich
und fand keine neuen besonderen Umstände, die zu einer Abweichung von seinem früheren Urteil geführt hätten.
Keine Verletzung von Artikel 8: der Gerichtshof unterstrich, dass „eine geschlechtsanpassende Operation nicht den Erwerb aller biologischen Merkmale des anderen Geschlechts nach sich zieht“ (Abs. 40).
Keine Verletzung von Artikel 12: die Bindung an das traditionelle Verständnis von Ehe bietet „ausreichende Gründe für die weitere Zugrundelegung biologischer Kriterien zur Geschlechtsbestimmung einer Person im Hinblick auf die Eheschließung“. Es ist Sache der Staaten, die Ausübung des Rechts auf Eheschließung zu regeln.
B. gegen Frankreich, 25.03.1992
Sachverhalt:
Eine Mann-zu-Frau Transsexuelle, Frau B., rügte die Weigerung der französischen Behörden, das Personenstandsregister ihren Wünschen entsprechend zu ändern.
Entscheidung:
Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): der Gerichtshof berücksichtigte Umstände, die den Fall von Rees gegen Vereinigtes Königreich und Cossey gegen Vereinigtes Königreich unterschieden, insbesondere die Unterschiede zwischen dem britischen und französischen System der Eintragung des Personenstandes. Während es im Vereinigten Königreich erhebliche Hürden für die Änderung von Geburtsurkunden gab, war es in Frankreich vorgesehen, Geburtsurkunden im Laufe des Lebens zu ändern. Der Gerichtshof stellte fest, dass in Frankreich viele offizielle Dokumente „eine Diskrepanz zwischen rechtlichem und offenkundigem Geschlecht eines Transsexuellen“ (Abs. 59) offenbaren, was auch die Angaben in Sozialversicherungsdokumenten und Gehaltsabrechnungen betrifft.
Der Gerichtshof entschied folglich, dass die Weigerung, den Eintrag der Beschwerdeführerin im Personenstandsregister zu ändern, sie „täglich in eine Situation {brachte}, die nicht mit der Achtung ihres Privatlebens vereinbar ist“.
X, Y et Z gegen Vereinigtes Königreich, 22.04.1997
Der Gerichtshof kam zwar zu dem Schluss, dass keine Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) vorlag, erkannte aber das Bestehen eines Familienlebens zwischen einem Transsexuellen und dem Kind seiner Partnerin an (Abs. 37: „X hat sich seit der Geburt in jeder Hinsicht wie der „Vater“ von Z verhalten. Unter solchen Umständen ist der Gerichtshof der Auffassung, dass [de facto] eine Familienbindung zwischen den drei Beschwerdeführern besteht.“)
Sheffield und Horsham gegen Vereinigtes Königreich, 30.07.1998
Der Gerichtshof befand, dass es keinen Grund gab, von seinen Urteilen in Rees gegen Vereinigtes Königreich und Cossey gegen Vereinigtes Königreich abzuweichen: „Transsexualität wirft weiterhin wissenschaftliche, rechtliche, moralische und soziale Probleme auf, denen die Vertragsstaaten nicht mit einer grundlegenden gemeinsamen Herangehensweise begegnen“ (Abs. 58).
Keine Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens), 12 (Recht auf Eheschließung und Familiengründung) und 14 (Diskriminierungsverbot). Gleichwohl „unterstreicht der Gerichtshof erneut, dass Entwicklungen in diesem Bereich weiterhin von den Vertragsstaaten beobachtet werden müssen“ (Abs. 60), und dies im Zusammenhang mit „der zunehmenden sozialen Akzeptanz des Phänomens und der zunehmenden Anerkennung der Probleme, denen postoperative Transsexuelle ausgesetzt sind“.
Christine Goodwin gegen Vereinigtes Königreich, Urteil der Großen Kammer, 11.07.2002
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin rügte, dass ihre Geschlechtsumwandlung rechtlich nicht anerkannt werde, insbesondere hinsichtlich ihrer Beschäftigungsbedingungen, hinsichtlich ihrer Sozialversicherungs- und Rentenrechte und da ihr das Recht auf Eheschließung verwehrt werde.
Entscheidung:
Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens), aufgrund der deutlichen internationalen Tendenz zu einer zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz von Transsexuellen und zur rechtlichen Anerkennung von Geschlechtsumwandlungen.
“Da es keine wichtigen Gründe des öffentlichen Interesses gibt, die dem Interesse der Beschwerdeführerin auf rechtliche Anerkennung ihrer Geschlechtsumwandlung entgegenstehen, kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass die gerechte Abwägung, die der Konvention immanent ist, nun eindeutig zu Gunsten der Beschwerdeführerin vorgenommen werden muss.“
Verletzung von Artikel 12 (Recht auf Eheschließung und Familiengründung)
“Der Gerichtshof ist nicht davon überzeugt, dass auch heute noch angenommen werden kann, dass [Artikel 12] sich auf eine Geschlechtsbestimmung nach rein biologischen Kriterien beziehen muss.“ (Abs. 100)
Der Gerichtshof befand, dass es dem Staat zusteht, die Voraussetzungen und Formalitäten von Eheschließungen Transsexueller zu regeln, dass er aber „keine Rechtfertigung dafür sieht, Transsexuellen in jedem Fall das Recht auf Eheschließung zu versagen“.
Nach dem Urteil der Großen Kammer im Fall Christine Goodwin führte das Vereinigte Königreich 2004 eine Regelung ein, nach der Transsexuelle eine amtliche Bestätigung über die Anerkennung des Geschlechts beantragen können.
R. und F. gegen Vereinigtes Königreich, November 2006
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführer waren beide verheiratet und hatten Kinder. Beide hatten eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen und blieben mit ihrem Ehepartner zusammen. Nach dem Gesetz von 2004 über die Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit beantragten beide die Ausstellung einer amtlichen Bescheinigung über die Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit, die sie aber nur im durch Beendigung ihrer Ehe hätten bekommen können. Sie machten eine Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) und 12 (Recht auf Eheschließung), geltend.
Entscheidung:
Beschwerden für unzulässig erklärt (abgewiesen als offensichtlich unbegründet): von den Beschwerdeführern wurde verlangt, ihre Ehen zu beenden, weil gleichgeschlechtliche Ehen nach englischem Recht nicht erlaubt waren. Das Vereinigte Königreich hatte die rechtliche Anerkennung von Geschlechtsumwandlungen zu möglich gemacht und die Beschwerdeführer hatten die Möglichkeit, ihre Beziehung fortzuführen und als Lebenspartnerschaft eintragen zu lassen, die fast die gleichen Rechte und Pflichten umfasste wie die Ehe.
Der Gerichtshof stellte fest, dass der Gesetzgeber von der kleinen Anzahl von verheirateten Transsexuellen wusste, als er die neue Regelung einführte, aber bewusst keine Sonderregelung für diese Ehen vorsah. Der Gerichtshof war der Auffassung, dass nicht verlangt werden konnte, diese geringe Zahl von Fällen gesondert zu berücksichtigen.
Schlumpf gegen die Schweiz, 08.01.2009
Sachverhalt:
Weigerung der Krankenversicherung der Beschwerdeführerin, die Kosten für eine Geschlechtsumwandlung zu übernehmen, weil sie vor der Operation nicht zwei Jahre abgewartet hatte, wie von der Rechtsprechung vorgesehen.
Entscheidung:
Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens): die Wartezeit wurde automatisch zugrunde gelegt, ohne das Alter der Beschwerdeführerin (67 Jahre) zu berücksichtigen.
P.V. gegen Spanien, 30.11.2010
Sachverhalt:
Eine Mann-zu-Frau Transsexuelle, bekam vor ihrer Geschlechtsumwandlung 1998 einen Sohn mit ihrer Ehefrau. Im Jahr 2002 trennte sich das Paar und die Beschwerdeführerin rügte nun die gerichtlichen Einschränkungen ihres Umgangsrechts mit ihrem Sohn mit der Begründung, dass ihre emotionale Unausgeglichenheit nach der Geschlechtsumwandlung auf das Kind verstörend wirken könne.
Entscheidung:
Keine Verletzung von Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 14: Die Einschränkungen des Umgangsrechts stellten keine Diskriminierung aufgrund der Transsexualität der Beschwerdeführerin dar. Der entscheidende Grund für die ihr von den spanischen Gerichten auferlegten Einschränkungen war angesichts der vorübergehenden emotionalen Unausgeglichenheit der Beschwerdeführerin das Kindeswohlinteresse. Sie legten daher eine Regelung fest, die es dem Kind ermöglichen würde, sich schrittweise an die Geschlechtsumwandlung seines Vaters zu gewöhnen.
P. gegen Portugal, aus dem Register gestrichen am 06.09.2011
Sachverhalt:
Bei ihrer Geburt wurde die Beschwerdeführerin als männlich registriert. Mit Erreichen des Erwachsenenalters unterzog sie sich einer Geschlechtsumwandlung. Sie rügte die fehlende rechtliche Anerkennung ihrer Situation, da es in Portugal keine entsprechende Gesetzgebung gebe. Es handelt sich um die erste Beschwerde dieser Art vor dem Gerichtshof gegen Portugal. Die Forderung der Beschwerdeführerin nach rechtlicher Anerkennung war vor den nationalen Gerichten erfolgreich, deshalb entschied der Gerichtshof, die Beschwerde aus seinem Register zu streichen.
| männlich | Männer bzw. Trans-Männer |
| weiblich | Frauen bzw. Trans-Frauen |
| inter | nur intersexuelle Personen |
| divers | nur intersexuelle Personen |
| offen | nur Neugeborene, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen |
| Streichung des Geschlechtseintrags | nur intersexuelle Personen |
Am 22. April 2015 stimmte die Mehrheit der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für die Resolution 2048 mit dem Titel „Diskriminierung von Transgender-Personen in Europa“. Die Resolution ist nicht rechtsverbindlich und ist daher als politische Absichtserklärung zu verstehen.
Der Europarat fordert in der Resolution 2048 unter anderem:
- Nationale Anti-Diskriminierungsgesetze auf Grundlage der geschlechtlichen Identität
- Internationale Menschenrechtsnormen ohne Diskriminierung der geschlechtlichen Identität
- Gesetze gegen Hassverbrechen zur Ahndung transphober Vergehen
- Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität beim Zugang zu einer Beschäftigung im privaten und öffentlichen Sektor, beim Zugang zu Wohnraum, zur Justiz und Gesundheitsversorgung
- Schnelle, transparente und leicht zugängliche Verfahren auf der Grundlage der Selbstbestimmung zur Änderung des Geschlechtseintrags in offiziellen Dokumenten
- Absehen von dem Erfordernis eines Nachweises über medizinische Behandlungen und Operationen, psychologische Gutachten sowie vom Erfordernis der Scheidung von aufrechten Ehen
- Streichung der Genderinkongruenz aus nationalen und internationalen Klassifizierungen von Krankheiten
- Sicherstellung und Übernahme durch gesetzliche Krankenversicherungen der Kosten der psychologischen und medizinischen Behandlungen
Quelle: http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=21736
Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts. Ziel der Europäischen Union (EU) im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern ist es zum einen, Chancengleichheit und Gleichbehandlung zu gewährleisten. Zum Zweiten zielt die EU darauf ab, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu unterbinden. Bei Gender Mainstreaming geht es darum, sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen so zu gestalten, dass die etwaigen Auswirkungen auf die Situation von Frauen und Männern bereits in der Konzeptionsphase aktiv und erkennbar integriert werden („gender perspective“). Die zentralen Gleichstellungsziele der EU sind:
- Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit
- Gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit
- Gleichstellung in Entscheidungsprozessen
- Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt
- Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in der Welt
Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen 2020-2025
Die Strategie zur Gleichstellung von LGBTIQ stellt eine neue Phase in den Bemühungen der EU um die Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, nichtbinären, intersexuellen und queeren Personen dar. Der Schwerpunkt dabei liegt weiterhin auf vorrangigen Bereichen, wie sie in den vier Säulen unterhalb dargelegt werden. Darüber hinaus wird betont, dass eine Dimension zur Gleichstellung von LGBTIQ in alle Politikbereiche und Finanzierungsprogramme der EU aufgenommen werden muss.
Die Strategie legt eine Reihe von gezielten Maßnahmen in insgesamt vier Säulen fest:
1. Bekämpfung der Diskriminierung von LGBTIQ-Personen
- Förderung der Inklusion und Vielfalt am Arbeitsplatz
- Bekämpfung der Ungleichheit in Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport
- Wahrung der Rechte von LGBTIQ, die internationalen Schutz beantragen
2. Gewährleistung der Sicherheit von LGBTIQ-Personen
- Verstärkung des rechtlichen Schutzes von LGBTIQ-Personen vor Hassdelikten, Hetze und Gewalt
- Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung von gegen LGBTIQ gerichtete Hetze und Desinformation
- Meldung von Hassdelikten gegen LGBTIQ und Austausch bewährter Verfahren
- Schutz und Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit von LGBTIQ-Personen
3. Aufbau von Gesellschaften, die LGBTIQ einschließen
- Sicherstellen der Rechte von LGBTIQ-Personen in grenzüberschreitenden Fällen
- Verbesserung des rechtlichen Schutzes für Regenbogenfamilien in grenzüberschreitenden Situationen
- Verbesserung der Anerkennung von trans* und nichtbinären Identitäten und von intersexuellen Personen
- Förderung eines positiven Umfelds für die Zivilgesellschaft
4. Führungsrolle bei der Forderung nach der Gleichstellung von LGBTIQ in der ganzen Welt
- Stärkung des Engagements der EU in Bezug auf Probleme von LGBTIQ in all ihren Außenbeziehungen
Die Yogyakarta Prinzipien wurden im Anschluss an das Treffen der Vertreter verschiedener NGOs und einiger UN Vertragsorgane sowie mehrerer UN Sonderberichterstatter, das vom 6. bis 9. November 2006 in Yogyakarta (Indonesien) stattfand, verabschiedet. 2007 wurden sie während einer Veranstaltung der Zivilgesellschaft im Rahmen der 62. Generalversammlung der Vereinten Nationen präsentiert. Die Yogyakarta Prinzipien sind rechtlich nicht bindend und bilden nicht das geltende Völkerrecht ab. Sie wurden von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen weder verhandelt noch anerkannt. Unterzeichnet wurden sie lediglich 29 Experten aus 25 Ländern.
Laut Eigenbeschreibung stellen die darin ausgeführten 29 Prinzipien und dazugehörigen Empfehlungen, „die Anwendung der internationalen Menschenrechte auf das Leben und die Erfahrungen von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten dar“.
Unter „sexueller Orientierung“ und „geschlechtlicher Identität“ verstehen die Yogyakarta Prinzipien folgendes:
„Sexueller Orientierung“ ist die „Fähigkeit eines Menschen, sich emotional und sexuell intensiv zu Personen desselben oder eines anderen Geschlechts (gender) oder mehr als einen Geschlechts (gender) hingezogen zu fühlen und vertraute und sexuelle Beziehungen mit ihnen zu führen“.
„Geschlechtlicher Identität“ ist das „tief empfundene innere und persönliche Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht (gender), das mit dem Geschlecht (sex), das der betroffene Mensch bei seiner Geburt zugewiesen wurde, übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Dies schließt die Wahrnehmung des eigenen Körpers mit ein (darunter auch die freiwillige Veränderung des äußeren körperlichen Erscheinungsbildes oder der Funktionen des Körpers durch medizinische, chirurgische oder andere Eingriffe) sowie andere Ausdrucksformen des Geschlechts (gender), z.B. durch Kleidung, Sprache und Verhaltensweisen“.
Die Yogyakarta Prinzipien umfassen Rechte, wie das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, das Recht auf Sicherheit und Schutz vor jeglicher Form von Gewalt und Übergriffen im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität und das Recht auf Schutz der Privatsphäre unabhängig von der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Neben der Bekämpfung von Gewalt und strafrechtlicher Verfolgung von Homosexualität umfassen die Yogyakarta Prinzipien jedoch auch Rechte, wie das Recht auf Arbeit, aufangemessenen Wohnraum, auf Bildung, auf das höchstmögliche Maß an Gesundheit, auf Meinungs- und Äußerungsfreiheit oder auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit – immer im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität.
Die einzelnen Prinzipien lauten:
- Prinzip 01. Das Recht auf universellen Genuss der Menschenrechte
- Prinzip 02. Das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung
- Prinzip 03. Das Recht auf Anerkennung vor dem Gesetz
- Prinzip 04. Das Recht auf Leben
- Prinzip 05. Das Recht auf persönliche Sicherheit
- Prinzip 06. Das Recht auf Schutz der Privatsphäre
- Prinzip 07. Das Recht auf Schutz vor willkürlicher Freiheitsentziehung
- Prinzip 08. Das Recht auf ein faires Verfahren
- Prinzip 09. Das Recht auf menschenwürdige Haftbedingungen
- Prinzip 10. Das Recht auf Freiheit von Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
- Prinzip 11. Das Recht auf Schutz vor allen Formen der Ausbeutung, vor dem Verkauf von Menschen und vor Menschenhandel
- Prinzip 12. Das Recht auf Arbeit
- Prinzip 13. Das Recht auf soziale Sicherheit und andere soziale Schutzmaßnahmen
- Prinzip 14. Das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard
- Prinzip 15. Das Recht auf einen angemessenen Wohnraum
- Prinzip 16. Das Recht auf Bildung
- Prinzip 17. Das Recht auf das höchstmögliche Maß an Gesundheit
- Prinzip 18. Das Recht auf Schutz vor medizinischer Misshandlung
- Prinzip 19. Das Recht auf Meinungs- und Äußerungsfreiheit
- Prinzip 20. Das Recht zur friedlichen Versammlung und Vereinigung
- Prinzip 21. Das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
- Prinzip 22. Das Recht auf Freizügigkeit
- Prinzip 23. Das Recht Asyl zu suchen
- Prinzip 24. Das Recht auf Gründung einer Familie
- Prinzip 25. Das Recht auf Teilhabe am öffentlichen Leben
- Prinzip 26. Das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben
- Prinzip 27. Das Recht auf die Förderung von Menschenrechten
- Prinzip 28. Das Recht auf wirksamen Rechtsschutz und Wiedergutmachung
- Prinzip 29. Verantwortlichkeit
Quellen:
http://yogyakartaprinciples.org
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/10/German_Translation.pdf
Kritik
Im Folgenden sollen exemplarisch einige Prinzipien herausgegriffen und kommentiert werden.
Prinzip 2: Das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung
„Alle Menschen haben Anspruch auf den Genuss aller Menschenrechte ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Alle Menschen haben Anspruch auf Gleichheit vor dem Gesetz und gleichen Schutz durch das Gesetz ohne derartige Diskriminierung und unabhängig davon, ob dies den Genuss eines anderen Menschenrechts berührt. Das Gesetz sollte jegliche Form der Diskriminierung verbieten und allen Menschen gleichermaßen wirksamen Schutz vor derartiger Diskriminierung garantieren. (…)
DIE STAATEN MÜSSEN
(…)
C. entsprechende gesetzgeberische und weitere Maßnahmen ergreifen, um Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität im öffentlichen wie im privaten Bereich zu verbieten und abzuschaffen; (…)“
Prinzip 2 erklärt die moralischen Kriterien zum Umgang mit Sexualität als „Diskriminierung“. Zugleich verlangt das Prinzip 2, dass andere Menschenrechte, die damit in Konflikt stehen, als nachrangig betrachtet werden sollen – wie etwa das Recht auf Privatleben, das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das Recht auf Eigentum sowie das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit.
Prinzip 3: Recht auf Anerkennung vor dem Gesetz
Jeder Mensch hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität müssen in allen Lebensbereichen in den Genuss der Rechtsfähigkeit kommen. Die selbstbestimmte sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität jedes Menschen ist fester Bestandteil seiner Persönlichkeit und eines der grundlegenden Elemente von Selbstbestimmung, Würde und Freiheit. (…) Kein rechtlicher Stand, wie beispielsweise die Ehe oder die Elternschaft, darf als Grund angeführt werden, um die rechtliche Anerkennung der geschlechtlichen Identität eines Menschen zu verhindern. Es darf auf keinen Menschen Druck ausgeübt werden, seine sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität zu verbergen, zu unterdrücken oder zu verleugnen.
DIE STAATEN MÜSSEN
(…)
B. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, damit die selbstbestimmte geschlechtliche Identität jedes Menschen in vollem Umfang geachtet und rechtlich anerkannt wird;
C. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass es Verfahren gibt, durch die auf allen vom Staat ausgegebenen persönlichen Dokumenten, in denen das Geschlecht (gender/sex) eines Menschen angegeben wird – z.B. Geburtsurkunden, Reisepässe, Wählerverzeichnisse usw. – die von der betroffenen Person selbst bestimmte geschlechtliche Identität genannt wird; (…)“
Wie erwähnt, ist die „geschlechtliche Identität“ in diesem Sinne gefühlsabhängig und variabel. Probleme, die durch einen „selbstbestimmten“ Geschlechtseintrag entstehen können und die damit in Verbindung stehenden Diskriminierungsverbote, sind vielfältig. Wenn sich beispielsweise ein verheirateter Mann dazu entschließen würde, als Frau leben zu wollen und die Ehefrau daran Anstoß nähme und sich aufgrund dessen scheiden lassen wollte, könnte dies gemäß der YP eine Diskriminierung darstellen.
Prinzip 16: Das Recht auf Bildung
„DIE STAATEN MÜSSEN
(…)
D. sicherstellen, dass die Lehrmethoden, Lehrpläne und Lehrmaterialien dazu geeignet sind, Verständnis und Respekt unter anderem für unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten zu fördern, wobei die damit in Zusammenhang stehenden besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden sowie ihrer Eltern und Familienangehörigen einbezogen werden; (…)“
Eltern sind als erste Erziehungsberechtigte verantwortlich für ihre Kinder. (vgl. Übereinkommen über die Rechte des Kindes Art. 5 und 18) Diese Verantwortung umfasst auch die Weitergabe von Werten. Gemäß Art. 2 EMRK hat der Staat bei Ausübung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen. Eine Sexualpädagogik, die beispielsweise postuliert, dass es keine biologische Geschlechtlichkeit gibt und damit Werte wie die beständige Treue zwischen Mann und Frau und den Zusammenhang mit der Weitergabe des Lebens verneint, kann diesem Recht der Eltern widersprechen.
In Prinzip 19 „Das Recht auf Meinungsfreiheit und Äußerungsfreiheit“ und Prinzip 20 „Das Recht zur friedlichen Versammlung und Vereinigung“ werden Sonderrechte für LGBTI*-Aktivismus gefordert. Diese Rechte dürften „nicht eingeschränkt werden durch sonst allgemeingültige Normen der „öffentlichen Ordnung, öffentlichen Moral, öffentlichen Gesundheit und öffentlichen Sicherheit“. Es wird das Recht gefordert, „Informationen und Gedankengut jeglicher Art mittels aller Medien und ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“
„DIE STAATEN MÜSSEN alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, (…)
B. dass die Produkte und Organisation staatlich kontrollierter Medien in Hinblick auf Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität pluralistisch und nicht-diskriminierend gestaltet sind; (…)
E. dass durch die Wahrnehmung der Rede- und Äußerungsfreiheit nicht die Rechte und Freiheiten von Personen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten verletzt werden; (…)“
Würde das Prinzip 20 akzeptiert, dann wären Vereinigungen, Versammlungen und Demonstrationen, welche den LGBTI*-Lebensstil propagieren, die einzigen, welche keiner Begrenzung durch die öffentliche Ordnung und Moral unterworfen wären. So dürften LGBTI*-Aktivisten Personen, die ihre Ansichten nicht teilten, beleidigen oder provozieren. Eine solche Privilegierung wäre nicht mit den demokratischen Prinzipien vereinbar.
Prinzip 24: Recht auf Gründung einer Familie
„Jeder Mensch hat unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität das Recht, eine Familie zu gründen. Es gibt die unterschiedlichsten Formen von Familien. Keine Familie darf aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität eines ihrer Mitglieder diskriminiert werden.
DIE STAATEN MÜSSEN
A. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um das Recht auf Gründung einer Familie ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität zu gewährleisten. Dies gilt auch für den Zugang zu Adoption und medizinisch unterstützter Fortpflanzung (einschließlich Samenspenden); (…)
C. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass (…) das Kindeswohl stets im Vordergrund steht und die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität des Kindes oder eines anderen Familienangehörigen oder einer anderen Person nicht als unvereinbar mit dem Kindeswohl gelten;
D. bei sämtlichen Handlungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit Kindern sicherstellen, dass Kinder, die sich eine persönliche Meinung bilden können, von dem Recht Gebrauch machen können, diese Meinung frei zu äußern, und dass diese Meinung entsprechend dem Alter und der Reife des Kindes gebührend berücksichtigt wird; (…)“
Jedes Kind hat das Recht bei seinen Eltern zu leben und von beiden Elternteilen erzogen zu werden, es sei denn, dies würde das Kindeswohl gefährden (vgl. Übereinkommen über die Rechte des Kindes Art. 7, 9 und 18). Die Eltern sind verantwortlich für das Kindeswohl. Das Recht des Kindes auf seine Eltern wird durch die YP auf ein Recht Erwachsener auf ein Kind verkehrt. Gemäß Europäischer Menschenrechtskonvention (EMRK) hat ein Mensch das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung, was aus Art. 8, dem Recht auf Privatleben abgeleitet wird (vgl. ebenso Übereinkommen über die Rechte des Kindes Art. 7). Das Kindeswohl muss gemäß der UN-Kinderrechtskonvention immer als vorrangiges Ziel staatlicher Maßnahmen gesehen werden. Durch reproduktionsmedizinische Maßnahmen, die zur Folge haben, dass das Kind entweder seine Eltern nicht kennt (z.B. anonyme Eizell- oder Samenspende, Leihmutterschaft) oder nicht bei seinen beiden Elternteilen aufwachsen kann, führt zu einer Verletzung des Kindeswohls. In den YP wird von einem ein Recht auf Gründung einer Familie durch die Nutzung von reproduktionsmedizinischen Maßnahmen (da es auf natürlichem Weg nicht möglich ist), unabhängig des Geschlechts oder der Familienverhältnisse gesprochen. Eine Einschränkung dieses „Rechts“ wird im Sinne der YP als „Diskriminierung“ eingeordnet und soll entsprechend sanktioniert werden. Zwar betonen die YP den Vorrang des Kindeswohls, wobei aber von vornherein wesentliche Elemente des Kindeswohls ausgeklammert werden.
Prinzip 27: Das Recht auf die Förderung von Menschenrechten
„Jeder Mensch hat ohne Diskriminierung aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität das Recht, allein oder gemeinsam mit anderen den Schutz und die Durchsetzung von Menschenrechten auf nationaler und internationaler Ebene zu fördern. Hierzu gehören auch Aktivitäten, die auf die Förderung und die Verteidigung der Rechte von Personen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten abzielen, sowie das Recht, neue Menschenrechtsnormen auszuarbeiten, zu erörtern und für deren Anerkennung einzutreten.
DIE STAATEN MÜSSEN
A. alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um ein positives Umfeld für Aktivitäten zur Förderung, Verteidigung und Verwirklichung von Menschenrechten zu schaffen, darunter auch von Menschenrechten, die sich auf die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität beziehen; (…)
C. sämtliche geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung von Handlungen oder Kampagnen ergreifen, die gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger, die sich mit Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität befassen, sowie gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten gerichtet sind;
D. sicherstellen, dass Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger, die sich mit Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität befassen, vor jeder Art von Gewalt, Bedrohungen, Vergeltungsaktionen, de facto oder de jure vorhandener Diskriminierung, Druck oder anderen willkürlichen Handlungen von Seiten des Staates oder nichtstaatlicher Akteure in Reaktion auf ihre Menschenrechtsaktivitäten geschützt sind. (…)“
Wie aus Prinzip 27 hervorgeht, geht es nicht nur um die Einhaltung der Menschenrechte, sondern um deren Weiterentwicklung. Dass das Recht sich weiterentwickelt, ist erforderlich. Die Frage ist allerdings, wer die Kompetenz hat, das Recht weiterzuentwickeln. Ein weiterer Punkt ist die Einhaltung der geforderten Maßnahmen wie in Prinzip 27 gefordert. Es braucht hier eine Art Überwachungsorgan, die die Staaten kontrolliert. Diese Funktion üben die „Monitoring Bodies“ der UN und die „Grundrechteagentur“ der EU aus.
Prinzip 29: Verantwortlichkeit
„Jede Person, deren Menschenrechte einschließlich der in den vorliegenden Prinzipien angesprochenen Rechte verletzt wurden, hat Anspruch darauf, dass diejenigen, die direkt oder indirekt für diese Rechtsverletzung verantwortlich sind, unabhängig davon, ob es sich um Behördenvertreter handelt oder nicht, auf eine Art und Weise für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden, die der Schwere der Rechtsverletzung angemessen ist. Es darf keine Straffreiheit für Personen geben, die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität begehen.
DIE STAATEN MÜSSEN
A. (…) Überwachungsmechanismen schaffen, um dafür zu sorgen, dass Personen, die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität begehen, zur Verantwortung gezogen werden können;
B. sicherstellen, dass (…) die Verantwortlichen bei entsprechender Beweislage strafrechtlich verfolgt, vor Gericht gestellt und angemessen bestraft werden;
C. unabhängige und wirksame Institutionen und Verfahren für die Überwachung der Erarbeitung und Umsetzung von Gesetzen und Maßnahmen schaffen, um die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität sicherzustellen; (…)“
Zu den YP gibt der „Activist´s Guide to The Yogyakarta Principes (AG)“ konkrete Handlungsanweisungen und -empfehlungen für „LGBTI*-Aktive und Interessierte“. Das Handbuch empfiehlt konkrete Umsetzungsstrategien bei der Umsetzung der YP. Juristisch findet die Umsetzung der Prinzipien häufig über den Weg höchstrichterlicher Urteile Eingang in die nationalstaatliche Gesetzgebung – beziehungsweise auf EU-Ebene über den Europäischen Gerichtshof (EuGH) oder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte EGMR. Die als Rechte deklarierten Forderungen sind teilweise keine bestehenden Menschenrechte, sondern werden als solche bezeichnet und dadurch von der breiten Öffentlichkeit angenommen und akzeptiert.
Finanziert werden die LGBTI+-Projekte durch offizielle Unterorganisationen der UN und EU sowie durch private Stiftungen/Geldgeber. Die „International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association“ (ILGA) finanziert sich hauptsächlich durch institutionelle Geldgeber wie öffentliche sowie private Einrichtungen. Im Jahr 2019 stammten 92 Prozent von ILGA-Europes Gesamtbudget aus Stipendien, 31 Prozent davon durch ein Stipendium der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission finanziert darüber hinaus Projekte der beiden weltweit größten Abtreibungsanbietern „Marie Stopes International“ und „International Planned Parenthood“.
Welche Ziele der Yogyakarta Prinzipien wurden in Österreich bereits erreicht?
Ehe für alle, Sexualpädagogische Programme an Schulen, Adoptionsrecht für homosexuelle Paare sowie reproduktionsmedizinische Maßnahmen für weibliche homosexuelle Paare.
Nächste Schritte: Leihmutterschaft – Vorstufe: Anerkennung der Elternschaft schon heute möglich, Verbot von Konversionstherapien bzw. non-affirmativen Beratungen (Deutschland, siehe YP 18), Levelling up – Antidiskriminierung „sexueller Minderheiten“ im Privatbereich
Quelle: Kuby Gabriele (2012), Die globale sexuelle Revolution, 1. Aufl., Kißleg, 107 ff. mwN.; hirschfeld-eddy-stiftung.de, Zugriff: März 2022; yogyakarthaprinciples.org, Zugriff: März 2022
Die YP plus 10 wurden am 10. November 2017 verabschiedet. Das Dokument reflektiert Entwicklungen im Bereich internationaler Menschenrechtsnormen und schließt nun auch Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale als eigenständige Bereiche ein. Während in den YP eine ausführliche Berücksichtigung von Problemen intersexueller Menschen noch fehlte, kommt Verstößen auf Grundlage von Geschlechtsmerkmalen in den YP+10 nun zentrale Bedeutung zu. Beide Dokumente sind gemeinsam zu lesen – die YP plus zehn korrigieren oder überschreiben die ursprünglichen YP nicht, sondern ergänzen sie.
Quellen:
https://www.boell.de/de/2018/12/10/die-yogyakarta-prinzipien-10
https://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/info-zentrum/yogyakarta-prinzipien/yp-10
Die International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI) Youth and Student Organisation (IGLYO), die Nachrichtenagentur “Thomas Reuters Foundation”, “Dentons” und mehrere andere Rechtsanwaltskanzleien haben sich 2019 zusammengeschlossen und einen Leitfaden mit Best Practice und erfolgreichen Strategien zur Erleichterung einer rechtlichen Änderung des Geschlechts für unter 18-Jährige erstellt.
- Als Motiv für ihre Kooperation geben die Beteiligten unter anderem die psychische Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden minderjähriger Transgender-Personen an.
- Die Möglichkeit den Geschlechtseintrag zu ändern wird in dem Papier immer wieder als Menschenrecht, das jeder Transgender-Person zustehe und aus mehreren geltenden Menschenrechten abgeleitet werden könne, bezeichnet. Juristische gesehen, gibt es aber keinen rechtsverbindlichen internationalen Vertrag oder darin enthaltene einzelne Bestimmungen, die sich ausschließlich an Transgender-Personen richten würde.
- Der Leitfaden sieht Kinder als selbständige Rechtssubjekte, die von ihrer Familie und ihren Eltern zu unterscheiden sind. Staaten seien daher dazu verpflichtet, gegen Eltern vorzugehen, wenn diese ihre Zustimmung zur rechtlichen Geschlechtsänderung oder zu Transgender-Behandlungen verweigern würden.
- Eine Muster-Rechtsordnung würde laut Leitfaden alle Transgender-Rechte auch auf Minderjährige ausweiten und das Erfordernis der elterlichen Zustimmung beschränken. Außerdem sollte eine Änderung der Geschlechtseintragung keine vorhergehende Sterilisation, Hormonbehandlung, geschlechtsumwandelnde Operation bzw. medizinische Diagnose erfordern.
- In Bezug auf Partnerschaften, sollte die Änderung des Geschlechtseintrags keine Auswirkung auf den Status der Beziehung haben und ohne Einwilligung des Partners durchgeführt werden können.
- Der Leitfaden plädiert zudem für einen einfachen Zugang zu kostenlosen geschlechtsanpassenden Therapien.
Quelle:
https://www.trust.org/publications/i/?id=8cf56139-c7bb-447c-babf-dd5ae56cd177
https://www.ief.at/internationale-strategien-der-transgender-lobby/