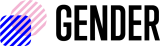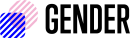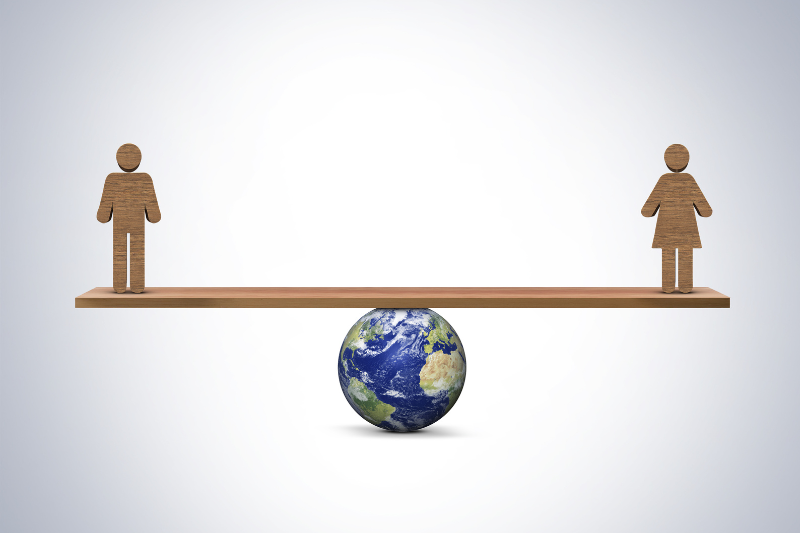Dilemma Frauensport: Inklusiv, aber unfair?
Bei der vergangenen Olympiade in Paris schlug der Fall Imane Khelif, 2021 die Teilnahme von Laurel Hubbard in Tokyo medial hohe Wellen: Fragen um die Relevanz des biologischen Geschlechts, um die Folgen der männlichen Pubertät, und damit um Fairness im Umgang mit Minderheiten, sowohl Intersexuellen als auch Transfrauen oder -männer, sind im Frauensport ungelöst.
Dass Klarheit fehlt, bedauern Sportlerinnen. „Seit letztem Jahr treten Transfrauen in der Frauenkategorie an. Das nimmt jedes Mal einer Frau die Gelegenheit, zur Olympia-Siegerin zu werden. Dabei ist das etwas, von dem wir alle träumen“, so eine britische Sportlerin gegenüber der BBC. Sie und eine zweite britische Athletin kritisierten bereits im Mai 2022 in einem Podcast des BBC die unkritische Öffnung der Frauenkategorie für Transfrauen. Dabei blieben sie anonym, weil sie weder Sponsoren vergraulen noch einen medialen Shitstorm wollten. „Männer- oder Frauenkategorien im Sport beschreiben keine Genderidentität“, so eine der beiden Sportlerinnen gegenüber der BBC: „Sie beschreiben das biologische Geschlecht und den Unterschied zwischen den biologischen Geschlechtern.“
Laut der Sportlerin schließe die Öffnung der Kategorie für Transfrauen biologische Frauen aus. „Die Frauenkategorie wurde gegründet, weil Frauen sonst keine Chance hätten, wenn sie gegen Männer antreten“, betont die anonyme Sportlerin. Laut den beiden Athletinnen ist dies die vorherrschende Meinung unter Sportlerinnen – doch es gibt eine hohe Hemmschwelle, sich öffentlich kritisch zu äußern.
Sportwissenschaftler Ross Tucker steht der Öffnung der weiblichen Kategorie für Transsportlerinnen ebenfalls kritisch gegenüber. Männer hätten einen biologischen Vorteil durch die Wirkung von Testosteron. „Bis bewiesen ist, dass dieser Vorteil nicht bei Transfrauen weiter existiert, gibt es meiner Meinung nach keine Grundlage, um Transfrauen in die Frauenkategorie zu nehmen“, so Tucker gegenüber der BBC. Im Gegenteil gebe es 13 Studien, die einen bedeutenden bleibenden Vorteil bei Transfrauen festgestellt hätten. Tucker warnte auch davor, aufgrund einer bisher vergleichsweise geringen Anzahl von Transfrauen in der Sportwelt die Öffnung der Kategorie zu banalisieren. „Sie nehmen Platzierungen im Wettbewerb von Frauen innerhalb der Frauenkategorie weg; mir kommt es daher gefährlich vor, hier Zahlenspiele zu spielen.“
Zwei Jahre später, in Paris, kocht die Diskussion erneut hoch: Diesmal ist es die algerische Boxerin Imane Khelif, an der sich die Debatte um das Geschlecht wieder entzündet. Die Lage ist kompliziert: Khelif ist nicht trans; es sickert aber durch, dass sie womöglich von DSD betroffen ist, also einer Störung der geschlechtlichen Entwicklung; dass sie vielleicht eine männliche Pubertät durchgemacht hat. Bilder von Khelif, die die italienische Boxerin Carini binnen Sekunden schlug, stellten Fragen nicht nur in Bezug auf sportliche Fairness, sondern auch auf die Sicherheit von Frauen im Sport. Das International Olympic Committee hält an der Zulassung von Khelif fest und erklärt: Einen Geschlechtstest gibt es laut dem International Olympic Committee aktuell nicht. Entscheidend sei das Geschlecht im Pass.
Zwei Fronten gegen Frauen: Alte Vorurteile, neue Ideologien
Dieser Trend, der sich seit einigen Jahren abzeichnet, droht wichtige Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung zu unterlaufen. Gleichzeitig gibt es immer noch Bereiche, in denen Frauen immer noch benachteiligt sind. So zum Beispiel im Gesundheitssektor: Im August 2024 erschien im Fachmagazin PNAS eine Studie mit Daten aus den USA und Israel, die nahelegt, dass Frauen nach dem Aufsuchen der Notaufnahme seltener ein Rezept für Schmerzmittel als Männer erhalten: Frauen erhielten in 38 Prozent der Fälle Schmerzmittel, Männer zu 47 Prozent. Frauen mussten laut der Studie außerdem 30 Minuten länger in der Notaufnahme warten.
Shoham Choshen-Hillel, Leiterin der Studie und Professorin der Hebrew University of Jerusalem, warnt vor schwerwiegenden Folgen durch die Unterbehandlung von Schmerzen. Diese könne zu längeren Genesungszeiten, Komplikationen oder chronischen Schmerzzuständen führen. Der Grund für die Unterschiede, so vermuten die beteiligten Ärzte, könnte eine „geschlechtsspezifische Verzerrung“ sein – ein Vorurteil, das im Übrigen sowohl unter den behandelnden Ärztinnen und Ärzten verbreitet sein könnte: „Es wird angenommen, dass Frauen ihre Schmerzen im Vergleich zu Männern übertrieben beschreiben.“ Möglich ist auch, dass Männer öfter nach Schmerzmitteln fragen.
Konkrete Fälle zeichnen ein trauriges Bild. Die 38-jährige Christina Pingel stirbt fast an einem Herzfehler, der jahrelang unbehandelt bleibt. Man führt ihre Symptome auf eine psychische Erkrankung zurück – bis sie eine Herzoperation braucht. „Der Arzt sagte mir damals, ich sei eine Dramaqueen und bilde mir das alles nur ein“, so Pingel gegenüber dem Standard. „Es ist wichtig zu verstehen, dass man nicht selbst schuld ist. Sondern dass das ein System ist und es einen Namen dafür gibt.“
Althergebrachte Vorurteile können das Leben von Frauen noch immer bedeutend treffen. Aber es ist etwas Neues hinzugekommen: Ideologien, die die Kategorien biologischer Geschlechter aufweichen wollen und damit drohen, Frauen unsichtbar zu machen. (SDU)